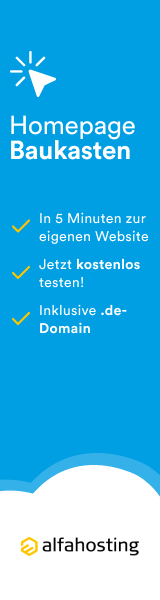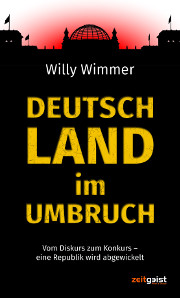zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Die güldene Sonne des Ostens
- Samstag, 27. September 2008 23:14
Gedanken über die Popularität des Dalai Lama und die Ausbreitung des tibetischen Buddhismus in Europa und den USA
Von HEIKO PETER
Wo Licht ist, ist üblicherweise auch Schatten. Und wenn letzterer fehlt, wirft dies Fragen auf. Der Dalai Lama verkörpert für viele wie kaum ein Anderer die Friedfertigkeit – und weiß diesen Trumpf auch geschickt in Szene zu setzen, insbesondere vor der Kulisse des übermächtigen chinesischen „Protektors“. Von einer dunklen Seite nichts zu sehen, zumindest nicht auf den ersten Blick – und genaueres Hinschauen ist nicht erwünscht (vgl. das Interview mit dem langjährigen Deutschübersetzer des Dalai Lama). Dennoch wagt der Autor, der vor Jahren selbst eine Audienz beim tibetischen „Gottkönig“ hatte, einen kritischen Blick auf dessen Person.
Die Welt ist im Wanken befindlich – und die Menschheit sich vermehrt dieser Situation bewusst, die einhergeht mit einer sich weiter ausbreitenden Resignation und Hilflosigkeit. Solch labile Zeiten boten und bieten den Rahmen für jene, die mit ihrem Sendungsbewusstsein, ihrer „Heilsmission“ an die Öffentlichkeit treten – vom einem Teil der Bevölkerung geschätzt und umjubelt, vom anderen belächelt oder abgelehnt. Eine Ausnahme diesbezüglich scheint der mittlerweile 73-jährige Tenzin Gyatso zu sein, besser bekannt als „Ozean des Wissens“: der 14. Dalai Lama als politisches und spirituelles Oberhaupt des tibetischen Volkes. Denn über seine Person wird (fast) nur Gutes berichtet.

Religion erlebt eine Renaissance, Asien ist hip, der indische Subkontinent lockt neben billigen Drogen auch verstärkt mit einer Mischung aus exotischem Fun und spiritueller Sinnsuche, Bollywood und Erleuchtung im Doppelpack. Da kommt ein Botschafter mit einem immerwährenden Lächeln, der es versteht, sich weltweit in die Herzen und Köpfe sehnsuchtsvoll suchender Menschen einzuschmeicheln, gerade recht. In beinahe dionysischer Benommenheit liegt ihm nicht nur verklärt-entschlossen das eigene Volk zu Füßen, auch Schauspieler – Sharon Stone, Richard Gere und Tina Turner als prominente Anhänger – und Politiker fast aller Nationen beugen sich demütig vor dem manifesten (Halb-)Gott in gelb. Auch wenn das Pentagon offiziell noch etwas zurückhaltend wirkt, so ist in Hollywood ein im passenden Rhythmus rezitiertes „Om mani padme hum“ sicherlich mehr im Trend als ein „Ave Maria“.
Stets heiter wirkende Mönche statt präpotente Kirchenfürsten, Nirwana-Hoffnung statt Dschihad-Drohung …
In der Ausgabe vom 20. März 1997 gibt die „Herald Tribune“ zu bedenken, „dass man sich erinnern sollte, dass Hollywood neben dem US-Militär die mächtigste Kraft der Welt ist“1. Auch „DER SPIEGEL“, welcher nicht gerade als religionsliberal gilt, unterwirft sich diesem Trend in erstaunlicher Weise. Der für ihn tätige Autor Erich Follath verfasste für die Ausgabe vom 14. Juli 2007 einen Artikel mit der Überschrift „Die Macht der Ohnmacht“, in dem er versucht, die wachsende Popularität des (tibetischen) Buddhismus im Gegensatz zur schwindenden Sympathie des Christentums im Westen zu ergründen und hinter das Klischeebild des Dalai Lama zu blicken, sofern es denn überhaupt eines gibt.
|
Welchen Zweck erfüllt das Kalachakra-Ritual? Das Kalachakra ist ein Text aus dem tibetischen Buddhismus (Sanskrit: kala: Zeit; cakra: Rad), übersetzt in etwa „Rad der Zeit“. Das darin beschriebene Ritual ist im Westen bekannt geworden als Initiierung des Weltfrieden bei Großveranstaltungen, allen voran durch den Dalai Lama. Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte ist es nicht ganz unumstritten, da es nicht originär auf Gautama Buddha zurückzuführen ist. Das Ritual enthält stark apokalyptische Züge, spricht eine zuweilen kriegerisch anmutende Sprache und ist auch wegen versteckter sexualmagischer Inhalte in die Kritik geraten. Dem Autor dieses Beitrags sind einige Menschen persönlich bekannt, die nach Teilnahme am Ritual über lang anhaltende Verwirrungszustände klagten und sich teilweise sogar in psychiatrische Behandlung begeben mussten. |
Die Worte, die er wählt, sind blumig-ausschweifend: Er zitiert nicht nur den Begründer der Berliner Love-Parade, Dr. Motte („Den Dalai Lama muss man einfach mögen, den lieben wir doch alle!“), sondern fragt auch mit eigenen Worten, „ob der Dalai Lama (nicht) der perfekte Repräsentant dieser sanften Weltmacht, eine unantastbare höchst moralische Instanz, zuständig für die Grundfragen der Menschheit, wie Lebenssinn, Glück, Gerechtigkeit und Frieden sei? Еin postmoderner Engel mit urzeitlichen, in Wiedergeburten stets reinkarnierten Wurzeln? Ein letzter gemeinsamer Nenner für Begeisterungsfähige und Skeptiker, Ohnmächtige und Übermächtige, Neurotiker und Naturburschen, eine Art Trostpflaster für die in Globalisierungsgegner und -gewinner sich zersplitternde Erde?“ Der gottgewordene Mensch, bescheiden, friedliebend, makellos, humorvoll, selbstkritisch, kosmopolitisch, zwischen den Welten wandelnd, unschuldig und rein. Bei so vielen schmeichelhaften Worten würde wohl selbst Gott eifersüchtig werden, wenn es ihn denn gäbe …
Laut einer vom SPIEGEL in Auftrag gegebenen Umfrage sehen 44 % der Befragten in Deutschland in der Person des Dalai Lama ein Vorbild für die Jugend und 43 % im Buddhismus eine friedfertige Religion. Zweieinhalb Jahrtausende weitgehende Friedfertigkeit statt grausamer Inquisition, stets heiter wirkende Mönche statt präpotente Kirchenfürsten, Nirwana-Hoffnung statt Dschihad-Drohung, meditative Überzeugungsarbeit statt missionarischer Bekehrung beeindrucken und überzeugen insbesondere die gut gebildete Oberschicht und Herr Follath fragt selbst, was denn daran falsch sein könnte. So kam es wohl auch dazu, dass der SPIEGEL, welcher sich ja gerne als die unkorummpierbare Avantgarde der deutsche Presselandschaft darstellt, diesen in seiner Aussagekraft an kindlich-unschuldige Naivität erinnernden Artikel veröffentlicht hat – in einem Themensegment, das ganz und gar nicht den üblichen Kern seiner Berichterstattung ausmacht.

Ist das buddhistische Reliquium der Stupa womöglich ein Hohlraumresonator, der zu magischen Zwecken genutzt werden kann? (im Bild: die 36 m hohe Stupa von Boudhanath, dem Zentrum der tibetischen Kultur in Nepal)
Doch wo liegen die wirklichen Ursachen dieses Verhaltens und der Popularität des Dalai Lamas, dass er so ungebremst in den westlichen Ländern seinen Siegeszug fortsetzen und seine Religion unter das Volk bringen kann? Nun, er vermag es wohl gekonnt, Ursehnsüchte in der menschlichen Seele anzusprechen oder zu erwecken, wie es Herr Follath in seinem Bericht ausführt – und ist gleichzeitig die geeignete Projektionsfläche für sie. Doch das Charisma seiner Person ist nicht die einzige Kraft, die hier wirkt. Seine Auftritte sind Events, die Massen in ihren Bann ziehen, wie es zuletzt im vergangenen Jahr in Hamburg zu erleben war. Das von ihm zelebrierte Kalachakra-Ritual (siehe auch Kasten) ist nicht das erste seiner Art auf europäischen Boden und wird wohl auch nicht das letzte sein, ist es doch eine einfache und machtvolle Art, Menschen mit eigenen Glaubens- und Wertvorstellungen zu beeinflussen. Da der tibetische Buddhismus den unantastbaren Ruf der Friedfertigkeit genießt, halte ich es für umso wichtiger, sich dessen Wurzeln resp. die Unterschiede zu anderen Richtungen der gleichen Philosophie einmal genauer anzusehen.
Wesentliche Wurzeln finden sich in der Tradition des Bön, der bis zum 8. Jahrhundert die vorherrschende Religion in Tibet gewesen ist und sich durch ein animistisches2 Weltbild und seinen Götterglauben definiert. Auf welche Weise er durch den auftretenden Buddhismus immer stärker verdrängt wurde, liegt im Bereich des Spekulativen, zumindest wurde – ähnlich wie die keltischen Bräuche im Christentum – vieles in die eigene Religion integriert. 1977 wurde der Bön vom Dalai Lama offiziell als eine spirituelle Schule Tibets anerkannt. Der Dalai Lama ist dank seiner lebenslangen Schulung ein Meister seines Fachs, ein hoher Magier seiner Loge, der sich der Kräfte der Götter aus dem alten Volksglauben bedient und sich diese untertan gemacht hat. Im Mittelpunkt dieses Kultes steht ein rituell gefertigtes Mandala, ein Objekt, welches ein enormes Potenzial an Kräften in sich bindet: Es versteht sich selbst als Tür zu physisch nicht sichtbaren Welten und soll transformierend wirken – für den Weltfrieden, weshalb der Dalai Lama auch keine Scheu hat, ein paar tausend Menschen pro Tag in diese Tradition einzuweihen und in der rituellen Zerstörung des Bildes die gespeicherten Kräfte freizusetzen, damit sie von dem ursprünglichen Errichtungsplatz aus wirken können.
Erhitzt der Bau einer Moschee die Gemüter aufs Ärgste, wird die Errichtung einer Stupa hingegen umjubelt
Darüber, um welche Kräfte es sich dabei wirklich handelt, hüllt er sich in bewusst lächelndes Stillschweigen, ganz so wie die Welt ihn liebt. Erhitzt der geplante Bau einer Moschee die Gemüter aufs Ärgste, wird die Errichtung einer Stupa3 hingegen umjubelt. Doch könnte es sein, dass es sich bei diesen Bauwerken, welche die klassisch-traditionellen Funktionen eines Reliquienschreins des Buddhas bei weitem übersteigen, um mehr als nur ein Mahnmal für den Weltfrieden handelt? Tibetischen Texten zufolge stellt eine Stupa symbolisch den Weg zur Erleuchtung da, ihr nicht zugängliches Inneres kann als Basis verschiedene Dinge verbergen, so etwa auch ein rituell gefertigtes Mandala oder Objekte, welche durch die Architektur in ihrer Wirksamkeit verstärkt werden. Physikalisch gesehen handelt es sich dabei um einen so genannten Hohlraumresonator4, der in einer eigenen Frequenz schwingt, wenn er dazu angeregt wird. Dieser Umstand ermöglicht es prinzipiell, Informationen wellenförmig zu übertragen. Magie und Macht sind zwei untrennbare Aspekte und ein gefährliches Geschäft. Schon Goethe wusste, wie schwer es ist, die Geister, die man unrechtmäßig rief, auch wieder loszuwerden, bevor sie sich in ihrem Tun verselbständigen.
Die jüngsten Ausschreitungen auf dem „Dach der Welt“ zeigen deutlich diese Kehrseite und – ohne mit dem chinesische Regime sympathisieren zu wollen – halte ich deren Verdachtsäußerungen, dass die Ausschreitungen in Lhasa vom Dalai Lama vorbereitet und initiiert worden sind für wahr, verhelfen sie doch seiner Persönlichkeit erneut um Mitgefühl ringend die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren, um auf die Unterdrückung seines Volkes hinzuweisen und das chinesische Feindbild zu verfestigen, vielleicht als letzte große Tat, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen gedenkt. Im indischen Exil lebend ist es kein politisch glücklicher Schachzug von großer Weitsichtigkeit im Interesse des Weltfriedens, die historisch gesehen nicht unbedingt freundschaftlichen Beziehungen beider Giganten zusätzlich zu provozieren und das gerade zu einem Zeitpunkt, wo der chinesische Minister Wen Jiabao mit seinem indischen Amtskollegen Manmohan Singh sich auf eine gemeinsame Vision für das 21. Jahrhundert in Bezug auf anhaltenden Frieden und gemeinsames Wachstum durch partnerschaftliches Miteinander geeinigt haben.5
Magie und Macht sind zwei untrennbare Aspekte und ein gefährliches Geschäft
Eigentlich wäre seine Heiligkeit am liebsten nur einfacher Mönch. Ohne seinen übermächtigen Gegner, pointiert Herr Follath in seinem Artikel, wäre der Dalai Lama womöglich wirklich nur ein Heiliger am Rande der Welt.
ANMERKUNGEN:
- Quelle: „Herald Tribune“, Ausgabe vom 20. März 1997, Seite 1 und 6 (Printversion)
- Animismus: Naturreligion mit der Vorstellung einer beseelten Umwelt und einem ausgeprägten Götter- und Dämonenglauben
- Stupa: aus dem Sanskrit stammende Bezeichnung für einen halbkreisförmigen Grabhügel, der über den Überresten einer verstorbenen Person errichtet wurde (stup: anhäufen). Im buddhistischen Umfeld auch Reliquienschrein bzw. Symbol für die Lehre Buddhas
- Hohlraumresonator: Anordnung, bei der die Innenwände eines Hohlraums derart angelegt sind, dass eine Welle an ihnen reflektiert und durch Resonanz verstärkt wird. Die im Inneren entstehenden Schwingungen (und mit ihnen die „enthaltenen“ Informationen) werden so nach außen getragen. Mehr zum technischen Einsatz von Hohlraumresonatoren findet sich in den Veröffentlichungen des deutschen Physikers Konstantin Meyl (www.k-meyl.de)
- Quelle: „A shared vision for the 21st century of the Republic of India and the People's Republic of China“; Thesenpapier eines Zusammentreffens am 14.01.2008 in Peking zwischen M. Singh und W. Jiabao; www.hinduonnet.com.
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems