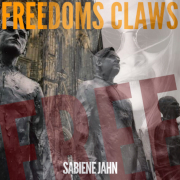zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
- Mittwoch, 10. Juni 2020 17:17
Ein Blick auf den Menschen hinter dem Künstler
Von ERIK KAN
„Ihre Energie wächst mit den Jahren“, so sprach einmal ein Handleser zu Rolf Hochhuth. Damit sollte er recht behalten – und prägnanter kann man den Entwicklungsprozess des umtriebigen Wesens von Hochhuth kaum auf den Punkt bringen. Nachruf eines langjährigen Weggefährten auf den im Mai 2020 verstorbenen Dramatiker.
Als ich ihm am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages 2004 das erste Mal über den Weg lief, konnte ich nicht ahnen, was sich aus dieser flüchtigen Begegnung entwickeln würde. An dem Tag herrschte allgemein gedrückte Stimmung – ein Tsunami im Indischen Ozean hatte morgens zehntausende Menschen in den Tod gerissen. Ich finanzierte mir damals mein Volkswirtschaftslehre-Studium durch den Abendverkauf von Zeitungen in Berlin-Mitte. Rolf Hochhuth kam mir auf der Straße entgegen, und ich sprach ihn mit auf einen schon etwas länger zurückliegenden Fernsehauftritt an. Meine Anregungen müssen ihm wohl imponiert haben, jedenfalls schlug er spontan vor, mir sein neuestes Manuskript zur kritischen Beurteilung zu überlassen.
Damit nahm eine freundschaftliche Beziehung ihren Lauf, die durch redaktionelle Begleitung und Zuarbeit bei einer Vielzahl seiner Texte immer weiter gefestigt wurde, sodass ich die Gelegenheit erhielt, diesen extrem produktiven Autor bei der Entstehung neuer Stücke, Essays, Gedichte etc. zu beobachten und seine so komplexe, widerspruchsfreudige wie widersprüchliche Persönlichkeit kennenzulernen. Bei zahlreichen Disputen, sei es inhaltlich oder wegen einzelner Formulierungen, flogen öfter mal ordentlich die Fetzen, was die Zusammenarbeit mit Hochhuth so lebendig wie anstrengend gestaltete. In der letzten Zeit machte sich eine vermutlich dem Alter geschuldete Dickköpfigkeit bei ihm bemerkbar, was dem offenen Austausch nicht gerade zuträglich war. Allerdings musste man ihm eines bei aller Offensivlust immer zugutehalten: Er war nie nachtragend und zitierte nach z. T. schonungslosen Gefechten gern einen seiner Lieblingssätze, der wohl von Richard Straus regelmäßig verwendet wurde: „In der Werkstatt gibt es keine Beleidigungen!“

Berlin, November 2019 – Treffen in Hochhuths Büro: Links sein Verleger Thomas Röttcher, rechts Erik Kan (Quelle: zeitgeist-Bildarchiv)
Hochhuth thematisierte in seiner Lyrik häufig den Tod und die Angst davor
Heftige Kontroversen waren beim engen Verhältnis mit einer derart streitbaren Person natürlich vorprogrammiert. Und doch wirkte Rolf Hochhuth trotz seiner zumeist klar vorgebrachten Positionen häufig zerrissen, und hinter der Fassade kamen immer mal wieder zaghafte Selbstzweifel zum Vorschein. Darüber hinaus schaffte er es problemlos, seine Haudraufmentalität mit Harmoniesucht und Ängstlichkeit zu vereinen – eine seiner vielen Ambivalenzen. Hierzu war auch die Widersprüchlichkeit zu zählen, dass er sich einerseits im kulturellen Sinne als Royalist verstand und der Demokratie mit Verachtung begegnete, sich andererseits aber für die sozial Schwächsten, die „Underdogs“, einsetzte und soziale Missstände und Demokratie einschränkende Haltungen anprangerte. Er forderte z. B. eine begrenzte Amtszeit von Politikern auf maximal zwei Legislaturperioden, ein Verbot von großen Koalitionen, außer in Notständen wie Krieg und Volksentscheide wie in der Schweiz. Dass jedoch Armut und Elend unter Monarchien keine seltenen Begleiterscheinungen waren, wurde von ihm geflissentlich bagatellisiert ...
In Hochhuths Kosmos passten eigentlich nur einer stringenten Logik folgende Figuren. Unergründliche Handlungen und Personen blieben ihm zumeist verdächtig, sodass er hier skeptisch Distanz einhielt, folglich auch zur gegenstandslosen Kunst, mit der er gar nichts anzufangen wusste. Und doch überkamen ihn immer wieder mal irrationale Anwandlungen. So verleugnete er einerseits die Existenz einer höheren Macht – was etwa im „Stellvertreter“ zutage tritt: Die Frage, ob der Holocaust möglich gewesen wäre, wenn es einen Gott gäbe, gab ihm den nötigen Impetus, das Stück anzugehen. Andererseits wurde es ihm schnell unheimlich, wenn er sich „merkwürdigen“, gar surrealen Ereignissen konfrontiert sah, weshalb er einer Auseinandersetzung mit allem Pythischen geradezu abergläubisch aus dem Weg ging – als könnte das irgendetwas mit ihm tun haben. Lieber hält er es mit Karl Marx: „Im Wirklichen selbst ist die Idee zu suchen!“ Nichtsdestotrotz begab er sich zu einem Handleser. Die eingangs erwähnte Anekdote ging sogar noch weiter und veranschaulicht bestens die Zwiespältigkeit seiner Persönlichkeit. Denn der Handleser traute sich nur, seine rechte Hand zu beurteilen, und verwies ihn bezüglich der linken an eine Kollegin, die sich besser auf das Deuten seiner ungewöhnlichen Linienverlaufe verstehe, was Hochhuth so sehr verstörte und ängstigte, dass er diese Dame nie aufzusuchen wagte.
Damit er die Kontrolle behalten konnte, musste alles logisch erklärbar sein. Nur auf diesem festen Fundament fühlte er sich sicher und spottete sogleich über Jaspers „Chiffren der Transzendenz“ oder die metaphysischen Ausflüge Goethes zum Thema Entelechie und Monaden. Hochhuth thematisierte in seiner Lyrik häufig den Tod und die Angst davor. Auch in Gesprächen spielte wiederholt die eigene Vergänglichkeit durchaus eine wichtige Rolle, einer Vertiefung aber widersetzte er sich (vielleicht der Garant für eine Langlebigkeit?) – es war manchmal schon bizarr, seine Fixierung auf den eigenen Tod bei gleichzeitiger Verweigerungshaltung, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, was ein weiteres Mal seine Zerrissenheit illustriert. Als Beispiel für diese innere Diskrepanz beim Thema Tod zitiere ich sein folgendes Gedicht, worin sich einerseits Hohn gegenüber scheinbarem Trost zeigt, andererseits die Einsicht in Verdrängungsmechanismen, die auch in ihm wirksam sind:
Verlangst aus Todangst
– eine Religion oder Ideologie:
Menschen mussten sie zum Trost erfinden,
pure Naturnotwendigkeit, denn allein durch sie
ertragen sie ihr Verschwinden!
Auch noch Arbeit – mildert Leid,
einzige, mindestens letzte Waffe gegen Nihilismus ...
Ihn verdrängen, das Hiersein zu verlangen
– bleibt das unentbehrliche Muss.
Die meisten Menschen werden Hochhuth eher als extrovertierten und unerschrockenen Hitzkopf gekannt haben, die grüblerischen und widersprüchlichen Facetten seiner Persönlichkeit aber blieben zumeist verborgen. Für Außenstehende, selbst wenn sie ihn sehr gut kannten, ja sogar für seine Ehefrau Johanna war häufig nicht nachvollziehbar, warum er gegenüber bestimmten Personen und Handlungen mit gnadenloser verbaler Härte vorging, bei anderen wiederum Einfühlungsvermögen und tiefes Verständnis zeigte: Der sonst so Rationale konnte plötzlich zum reinen Bauchmenschen mutieren. Hochhuth war eben immer wieder für Überraschungen gut, und man konnte kaum voraussehen, zu welchen Ergebnissen er am Ende kommen würde. Diese Unberechenbarkeit machte es spannend: Der Autor und sein Werk fordern einen permanent. Auch mir hatten sich manche seiner Argumente und Ausführungen in all ihrer Dialektik nie ganz erschließen können. So war er ein erklärter Bewunderer von Bismarck und dessen Leistungen, allem voran der Einigung des Reichs, um an anderer Stelle wieder Königsmord zu begehen, indem er fragte, ob Bismarck einen Hitler überhaupt erst ermöglicht hat. Ähnlich janusköpfig war seine Haltung gegenüber Churchill.

Rolf Hochhuth bei der Arbeit (Bildquelle: Erik Kan)
Bei der Arbeit war Hochhuth nicht selten von bestimmten Themen so besessen, dass sie ihn über Monate, manchmal Jahre fesseln konnten. Er verbiss sich gern – Exbundeskanzler Ludwig Erhard bezeichnete ihn einst gar wegen seiner politischen Einmischung als „kleinen Pinscher“. In jüngerer Vergangenheit hatte ihn der sich immer weiter verschärfende Konflikt zwischen NATO und Russland gepackt. Dabei sah er die US-dominierte NATO als treibende Kraft hinter der Fehde, die seiner Ansicht nach jederzeit in einen dritten Weltkrieg münden konnte. Aufgrund der verbesserten Kommunikation zwischen den Präsidenten Trump und Putin, legte sich diese Angst etwas. Dass Amerika keinerlei Interesse zeigte, die Bedrohung entschärfen zu wollen, sondern vielmehr mit Expansion und Aufrüstung antwortete, beunruhigte Hochhuth die Jahre vor der Trump-Ära zutiefst. Nachdem die akute Kriegsgefahr gebannt schien, widmete er sich der Frage nach dem Massenmord an den Indianern: Wie gelang es den Amerikanern, ihren Genozid konsequent aus dem kollektiven Bewusstsein herauszuhalten? Der Umstand, dass die meisten Vorfahren haben, an deren Händen Blut klebt, trieb ihn ziemlich um und ließ ihn bis zu seinem Tod nicht mehr los. Über dieses Trauma wie auch die illegale Landnahme der weißen Einwanderer hatte er noch begonnen, ein Stück zu schreiben – es sollte jedoch unvollendet bleiben.
Das Schreiben, sieben Tage die Woche, war für Hochhuth Lebenselixier und Obsession zugleich
Das Schreiben, sieben Tage die Woche, war für Hochhuth Lebenselixier und Obsession zugleich: Als echter Workaholic konnte er nicht anders, immerzu musste er schnell noch etwas notieren, selbst in der arbeitsfreien Zeit. Dass seine Energie in der Tat mit den Jahren wuchs, vermochte jeder, der mit ihm zu tun hatte, täglich bewundern. Vermutlich war das auch der Grund, dass bislang keine Spur von Altersmilde bei ihm zu erkennen war – im Gegenteil: Bis zuletzt wollte Hochhuth desavouieren, aufrütteln! So bediente er sich auch der Polemik, was legitim ist, um der Öffentlichkeit gesellschaftliche oder politische Missstände vor Augen zu führen. Allerdings passierte es bei dieser Herangehensweise manchmal, dass er ohne Not übers Ziel hinausschoss, wodurch seine Aussagen nur noch wie Alarmismus erschienen. Welch ein Jammer, denn die meisten seiner Analysen waren durchaus schlüssig! Ab und an also hätte die Besinnung darauf, dass weniger manchmal mehr sein kann, dem ungestümen Insurgenten auch mal gutgetan. Nichtsdestotrotz gab es in Deutschland weit und breit keine Person, die mit fast 90 noch so auf Krawall gebürstet war wie Rolf Hochhuth. Und gerade vor dem Hintergrund aktueller Geschehnisse und der flachen Debatte um eine fehlende Leitkultur wird deutlich, dass unkonventionelle Denker wie er diesem Land nun fehlen werden.
Hochhuths Leidenschaft stieß allerdings auch an Grenzen: So nutzte dieser unermüdliche Schreibdinosaurier nach wie vor allein seine Schreibmaschine. Computer waren ihm suspekt, folglich musste er notgedrungen alle Texte diktieren, damit sie digitalisiert werden konnten. Dabei beeindruckte es immer wieder, wie er aus dem Stehgreif lange, verschachtelte Sätze druckreif ausformulierte. Und wenn ihm etwas trotzdem noch nicht stimmig genug erschien, dann war es für ihn ein Leichtes, ganze Passagen komplett neu zu kompilieren, als sei das nichts. Hochhuth war ein wahrer Wortakrobat, ein Feinmechaniker der Sprache. Tagelang feilte er, wenn nötig, mit einer Schafsgeduld, an einem einzigen Kurzgedicht von zehn Zeilen. Neben seiner Arbeitsdisziplin imponierte er durch sein Wissen und die Erinnerungsgabe, die sich auf weite Teile der Kunst und Geschichte über alle Epochen hinweg erstreckte. Führt man sich vor Augen, dass er sich all das ebenso wie seine Sprachfertigkeit autodidaktisch angeeignet hatte – denn zum Abitur brachte er es nie –, wird seine Kämpfernatur erst richtig klar. Im elitären Literaturbetrieb durfte es ihm als Nichtakademiker nicht leichtgefallen sein, sich derart nachhaltig zu etablieren. Hochhuths bewusster Verzicht auf die Hochschulreife gründete darauf, dass er sich seiner Berufung als Schriftsteller gewiss war – nur zum Schreiben glaubte er fähig zu sein. Besonders ermutigte den jungen Hochhuth die Tatsache, dass die drei deutschen Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Hermann Hesse ebenfalls ohne Abitur zum Erfolg kamen. Entsprechend bezeichnete er seinen Alles-oder-nichts-Entschluss als Resultat einer Mischung aus Größenwahn und Zerknirschtheit.
In den letzten Jahren jedoch machte Hochhuth der gesellschaftliche Wandel merklich zu schaffen. Die Verlage sind entpolitisiert, die wenigsten entziehen sich dem Kommerzialisierungsdiktat und lehnen eine deutliche, gesellschaftspolitisch unbequeme Positionierung der Autoren ab. Gewünscht ist Massentaugliches, gern auch seichte Ware, am liebsten natürlich gleich mit Bestsellergarantie – also genau das Gegenteil von Hochhuths Verständnis von Literatur. Natürlich erstreckt sich die Entpolitisierung nicht nur auf die Verlagswelt, sondern reicht sehr viel weiter. Die blind-kritiklose Hinnahme unserer, wie er sagte, „kriegsverschonten und dadurch glückverdummten Generation“, etwa bei Sozialthemen wie dem Lokführerstreik oder der weltweiten atomaren Aufrüstung, sah Hochhuth als Konsequenz eines Softiezeitgeists, in den auch die neue Political Correctness passt: Im Vergleich zu früher wirken heute alle öffentlich geführten Debatten, sei es in Talkshows oder Parlamenten, wie weichgespült und zunehmend regierungsunkritisch. Das Credo lautet: Bloß nicht anecken. Jede kritische Einstellung, die vom Mainstream abweicht, wird durch Attribute wie „intolerant“, „radikal“ oder „feindlich“ gebrandmarkt. Jemand wie Hochhuth war da ein störendes Sandkorn im Getriebe. Der Konsenszwang aber verhindert eine echte Streitkultur und damit genau das, wofür ein alter Haudegen wie er einstand.
Sein Lebenswerk umfasst die unterschiedlichsten literarischen Gattungen und ist auch thematisch kontrastreich. Auf einen Schwerpunkt seiner über sechs Jahrzehnte währenden Schaffensphase möchte ich hier den Blick lenken: Helden, vor allem des Dritten Reichs. Hochhuth stellte sich stets auf die Seite der Schwächeren, sein Faible für Einzelkämpfer und Märtyrer zieht sich durchs gesamte Werk. Genannt seien Elser, Turing, Bavaud, Tell, Fontana, Gerstein oder Snowden. Rolf Hochhuth war bei Kriegsende gerade 14 Jahre alt. Dennoch zeigte sich bei ihm ein gewisses Schuldgefühl, das in seiner, wie Günter Gaus es für Helmut Kohl formulierte, „Gnade der späten Geburt“ gründete. Er schrieb Deutschland eine Kollektivschuld zu, auch uns heutigen Bewohnern, und war davon überzeugt, dass wir dereinst für die Verbrechen in einem dritten Weltkrieg zur Rechenschaft gezogen würden. Hochhuths latent schlechtes Gewissen wurzelte wohl darin, dass er sich, einige Jahre früher geboren, an dem System in irgendeiner womöglich fragwürdigen Form hätte beteiligen müssen. Dass einfache Leute wie Elser oder Bavaud sich nicht manipulieren ließen und bereit waren, ihr Leben zu opfern, erfüllte ihn mit Scham. Die Aufarbeitung und Publikation solcher Schicksale bedeutet für Hochhuth eine Art der persönlichen Vergangenheitsbewältigung, die Abtragung einer fiktiven Schuld, die dank seines Geburtsjahres nie zur Realität wurde.
In der letzten Phase seines Lebens widmete sich der Autor passioniert einer speziellen Form der Poesie: Liebesgedichten mit deutlich pornografischer Note. Mithilfe plakativ derber Sprachelemente feierte er den Frauenkörper wie den Liebesakt, teilweise in hemmungslos wollüstigen Versen – herausgefordert dadurch, wie er sagte, dass der Akt in der Dichtkunst über viele Generationen hinweg nur in keuschen Andeutungen umschrieben wurde. Diesem Biedermeier-Puritanismus suchte er mit seiner Art der Anbetung des Weiblichen etwas entgegenzusetzen, um verkrustete Lyrikkonventionen radikal aufzubrechen.
Über diese gezielten Provokationen ließe sich ebenso wie über fast jeden einzelnen Text, vermutlich sogar über das ganze Hochhuth’sche Werk ausgiebig wie kontrovers diskutieren, weil die kämpferisch vorgetragenen Thesen jeden Leser in ihrer Sprachgewalt dezidiert wie verstörend herausfordern. – Das genau war seine Absicht! Vielleicht erspürt man in der Folge sogar die von Evelyn Finger in der „Zeit“ hervorgehobene Faszination: die „Schönheit dialektischen Denkens“, vermittelt durch Rolf Hochhuth.
Wer sich kennt, durchschaut
‒ weiß, dieser Trend im Abgang in allen:
Durch Plackerei lange Jahre seelisch-leiblich abgebaut,
macht Alterspanik Angst, ins Nichts zu fallen ...
Dagegen erfindet Goethe Monaden,
Jaspers „sieht“ Chiffren der Transzendenz.
Beides nichts als ausgedacht, doch da von Großen, nicht verlacht.
Kann ja auch nichts schaden.
Sogar hilfreich gegen geistige Inkontinenz.
Umso „bedeutender“ formulieren Erfinder ‒ je weniger dahinter.
Wie so oft reflektierte der Dichter auch in diesem Kurzgedicht seine eigene Endlichkeit. Gegen Goethes und Jaspers Ausblicke auf ein irgendwie geartetes Fortbestehen der Existenz in der jenseitigen Welt bezog er jedenfalls klar Stellung. Der Beschäftigung mit dem eigenen Tod bot er trotz seiner defätistischen Grundhaltung privat wie künstlerisch dennoch erstaunlich viel Raum.
… getrieben von der Sorge, die letzte Idee, den letzten Gedanken nicht mehr rechtzeitig schriftlich für die Nachwelt festhalten zu können
Typisch dafür steht die Anekdote, die sich bereits knapp zwei Jahrzehnte vor seinem Tod zutrug. Nachdem er erfahren hatte, dass er den Jacob-Grimm-Kulturpreis Deutsche Sprache erhalten sollte, besuchte er spontan die vier Gräber der berühmten Gebrüder auf dem Berliner St.-Matthäus-Kirchhof. Als er neben der Grimm’schen Ruhestätte einen freien Platz entdeckte, erwarb er sodann die Grabstelle. Die Episode verewigte er seinerzeit in folgenden Verszeilen:
Alter Matthäi Kirchhof Yorckstraße
S1, Kurzstrecke ab Brandenburger Tor.
Dort liegen wir bald bei den Brüdern Grimm,
zwei Dichter, wie Kotzebue gesegnet mit Humor:
,Bremer Stadtmusikanten‘. Doch wie kein Poet im
„Klassischen“ Weimar, das die Nachwelt kennt …
Faktum: Gedankenübertragung ist eine Realität
– obgleich so unerforscht, wie’s Firmament.
Gibt’s, auch unerforscht, ein Happy-End – noch spät?
Stauffenberg und die mit ihm an die Wand gestellt,
wurden hier am 20. Juli nur für Stunden verscharrt:
Hitler befiehlt, den Vorahnung eines Denkmals erhellt:
„Ausgraben, verbrennen!“ – Asche zum Müll gekarrt.
Auf den Gräbern der Grimm – mit Steinen beschwert –
Märchenbilder von Mädchen, von Jungen.
Noch nach 200 Jahren so geliebt, so geehrt
– welches Buch sonst, in aller Völker Zungen.

Die gemeinsame Ruhestätte von Rolf Hochhuth und seiner dritten Ehefrau Ursula Euler (gest. 2004) in direkter Nachbarschaft zu den Gräbern der vier Brüder Grimm auf dem Friedhof St.-Matthäus-Kirchhof, Berlin-Schöneberg (Bildquelle: Erik Kan)
Viele seiner Gedichte kommen Nekrologen gleich. Darin ringen der Glaube an schicksalhafte Vorbestimmung und die Angst vor totaler Vergänglichkeit miteinander – zusätzlich getrieben von der Sorge, die letzte Idee, den letzten Gedanken nicht mehr rechtzeitig schriftlich für die Nachwelt festhalten zu können. Konsequenterweise bleibt Hochhuth im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten Tag auch ein Kämpfer in eigener Sache, primär für sein schriftstellerisches Erbe. Es sollte unbedingt noch zu Lebzeiten geregelt sein, getreu seinem eigenen Aphorismus: „Nachlass kommt von nachlässig!“
Geradezu sinnbildlich hierfür steht Hochhuths Impuls, mich noch am Tage vor seinem Tod anzurufen, um sich über den Stand eines seit Monaten ins Stocken geratenen Buchprojektes zu erkundigen und wie man dessen Erscheinen doch noch erwirken könnte. Und einem weiteren fertigen Manuskript, dessen Veröffentlichung er selbst zwei Jahre verzögert hatte, obwohl die Zusage des Verlags schon vorlag, gab er noch grünes Licht. Dahinter steckte wohl auch die Gewissheit, unsere Welt sehr bald verlassen zu müssen. Diese Vorahnung beruhte nicht unwesentlich auf einer rund fünf Jahre zurückliegenden „Prophezeiung“ durch eine von ihm selbst erkorene Wahrsagerin, die ihm 89 als Sterbealter nannte.
Hochhuth verweigerte sich einerseits der Annahme des Transzendenten, um gleichzeitig Überlieferungen von mystischen Todesankündigungen bekannter Literaten über deren bevorstehendes Ende als Gegenbeweis anzubringen
Hochhuth führte mit mir nicht nur einmal intensive Debatten zu dieser existenziellen Kernfrage, der Vorherbestimmung, als scheinbarer Verfechter des Agnostizismus. Besonders interessant hierbei war der Umstand, dass er sich einerseits der Annahme des Transzendenten verweigerte, um gleichzeitig Überlieferungen von mystischen Todesankündigungen bekannter Literaten über deren bevorstehendes Ende als Gegenbeweis anzubringen. Seiner Logik zufolge bedurften so eindeutig vorherbestimmte Ableben wiederum eines höheren göttlichen Plans.
In diesem Zusammenhang thematisierte er ein ums andere Mal so ungewöhnliche Todesumstände wie die von Hugo von Hofmannsthal (1874–1929), Ernst Stadler (1883–1914) und Ödön von Horváth (1901–1938). Deren drei Schicksale sollen an dieser Stelle kurz nachgezeichnet werden, um sich ein Bild davon zu machen, welche Eindrücke Hochhuths Geist prägten:
Hugo von Hofmannsthals Tod kündigte sich ihm in Gestalt eines Angsttraums an. Kurz bevor sein Sohn Franzl sich mit 26 Jahren erschoss, träumte der Vater etwas, was ihn zutiefst erschüttern sollte. Im Traum wollte er wie üblich seinem Spazierhut von der Garderobe nehmen, bekam ihn aber einfach nicht zu fassen, was immer er auch unternahm. Der Hut entzog sich einfach seinem Zugriff. Die Besorgnis darüber hielt dessen Familie am nächsten Morgen für übersteigert. Als Hofmannsthal jedoch einige Tage später zur Beerdigung seines Sohnes aufbrechen und nach dem Hut greifen wollte, erlitt er einen tödlichen Schlaganfall.
1913 stimmt der Germanist Ernst Stadler einer Gastprofessur an der Universität von Toronto zu, die er im September 1914 antreten soll. Daraufhin entsteht der bedeutende expressionistische Gedichtband „Der Aufbruch“. Stadler erkennt als gebürtiger Elsässer früh die drohende Kriegsgefahr und setzt sich darin für den Erhalt des Friedens ein. Im Mai 1914 überredet ihn der Schriftsteller Otto Flake, mit dem auch Hochhuth eng befreundet war und so von jener Begebenheit erfuhr, in Paris aus Jux eine Wahrsagerin aufzusuchen, die ausgerechnet den Namen jenes Straßburger Vororts trug, in dem Stadler aufgewachsen war: Robertsau. Die Dame prophezeit ihm, dass er eine geplante größere Reise nicht antreten und noch im gleichen Jahr eines gewaltsamen Todes sterben werde. Als er dann Ende Juli 1914 als Reserveoffizier eines Artillerieregiments einberufen wird, ist ihm aufgrund des Orakels angst und bange. Nur drei Monate später wird er von einer Granate zerfetzt. Seine Gebeine liegen auf dem Friedhof von Robertsau begraben.
Der ungarische Schriftsteller Ödön von Horvarth, der gerne über seltsame Unglücksfälle sprach, hatte zeitlebens eine unerklärliche Angst vor Straßen. Neben Autos mied er auch Flugzeuge und Fahrstühle. Im März 1938, nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, floh er unter großen Schwierigkeiten über die gesperrte Grenze. Klaus Mann überlieferte, dass Horvath gesagt haben soll: „Vor den Nazis habe ich keine so sehr große Angst … Es gibt ärgere Dinge ... Straßen können einem übelwollen, können einen vernichten.“ In Amsterdam, einer Zwischenstation, wurde ihm im Mai 1938 weisgesagt, dass ihn in Paris „das größte Abenteuer seines Lebens“ erwarten würde. Er plante ohnehin nach Paris zu reisen, um dort mit dem späteren Hollywood-Regisseur Robert Siodmak über die Verfilmung seines bedeutendsten Romans „Jugend ohne Gott“ zu sprechen. Dessen Angebot nach dem Treffen, ihn mit dem Auto nach Hause zu bringen, schlägt Horvath mit den Worten aus, er gehe lieber zu Fuß. Alsdann brach ein Sommergewitter aus, welches auf der Champs-Élysées den Ast eines Kastanienbaums abbrechen ließ, der Horvaths Kopf zerschmettern sollte …
Sind Hochhuth diese verhängnisvollen Tode ungewollt zu nahe gegangen? Versuche, ihm auszureden, dass solcherlei Voraussagen nicht zwangsläufig eintreten müssen, scheiterten. Die „89“ schien für ihn wie in Stein gemeißelt.
Am 13. Mai 2020 starb Rolf Hochhuth im Alter von 89 Jahren – so, wie es ihm prophezeit wurde.
Für die Traueranzeige wählte seine Ehefrau Johanna Binger den treffenden Hochhuth-Aphorismus „Fort sein ist auch ein Sein, nicht Nichts“ ...
Erweiterte und stark überarbeitete Fassung eines Essays, der 2016 in Hochhuths letztem großen Sammelwerk „Ausstieg aus der NATO – oder Finis Germaniae. Katastrophen und Oasen“ erstveröffentlicht wurde.
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems