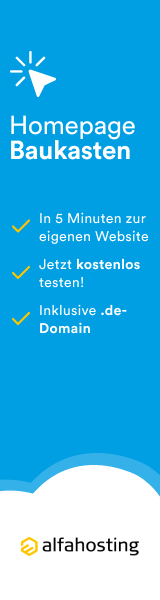zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Die Steinzeit war erst vorgestern: Warum uns die moderne Zivilisation zu schaffen macht
- Montag, 21. Mai 2012 13:33
Von ROLF W. MEYER
Überfluss, Schnelllebigkeit, Anonymität – die rasante kulturgeschichtliche Entwicklung, im Speziellen das Zeitalter der Globalisierung, stellt uns vor gewaltige Herausforderungen. Denn der moderne Mensch wurde quasi, einem Zeitreisenden gleich, „von heute auf morgen“ in eine ihm fremde Welt katapultiert. Entsprechend desorientiert verhält er sich. Ohne Zweifel, die Komplexität des Lebens im 21. Jahrhundert stresst uns – mit entsprechenden Konsequenzen. Welche das sind, erläutert zeitgeist-Autor Rolf W. Meyer anhand ausgewählter Beispiele.
Etwa 99,6 % seiner 2,5 Mio. Jahre andauernden Stammes- und Kulturgeschichte lebte der Mensch ausschließlich als Jäger und Sammler in überschaubaren Sozialverbänden. In den letzten 10.000 Jahren (die fehlenden 0,4 %) hat er seine natürliche Umwelt tiefgreifend, seinen Bedürfnissen entsprechend, umgestaltet. Diese Entwicklung hat sich mit Beginn der Industrialisierung dramatisch beschleunigt. Unser Leben wird heute von hochentwickelter Technik und in immer stärkerem Maße von „megaurbanen Regionen“ geprägt. Gegenwärtig leben über 50 % der Weltbevölkerung in Städten. Im Zeitalter der profitorientierten Globalisierung denken, fühlen und handeln wir allerdings noch immer mit einer „Steinzeitpsyche“.
Der menschliche „Steinzeitkörper“ hat sich an die Herausforderungen der modernen „Zivilisation“ überhaupt nicht oder nur geringfügig anpassen können
Denn der menschliche „Steinzeitkörper“ hat sich an die Bedingungen und Herausforderungen der modernen „Zivilisation“ überhaupt nicht oder nur geringfügig anpassen können. Während sich der Lebensbereich des Einzelnen in relativ kurzem Zeitraum völlig veränderte, zeigte dies kaum Auswirkungen auf seine uralten Erbanlagen (genetisch wie epigenetisch1). Hierin liegt eine wesentliche Ursache, warum immer mehr physische und psychische Erkrankungen bei Mitmenschen zu beobachten sind. Unsere biologische Evolution kann mit der kulturellen Evolution einfach nicht mehr Schritt halten. Diese „Missevolution“, wie sie von Daniel E. Lieberman, Professor für Humanevolution an der Harvard University, Cambridge (USA), bezeichnet wird, soll an verschiedenen Beispielen illustriert werden.
Der Mensch ist von Natur aus ein Läufer
Während wir noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast alle kürzeren Wege, die in die Nachbarschaft führten, zu Fuß zurücklegten, scheinen wir in unserer hochmobilen Gesellschaft die jahrtausendlang unverzichtbare Funktion unserer Hinterextremitäten mehr und mehr zu vergessen. Wissenschaftlich ist belegbar, dass Laufen, in Maßen und mit der richtigen Einstellung betrieben, Fehlfunktionen des Abwehrsystems, des Kreislaufs und des Stoffwechsels ebenso günstig beeinflussen kann wie seelische Verstimmungen. Daraus lässt sich umgekehrt folgern, dass Bewegungsmangel die Ursache für körperliche und seelische Fehlfunktionen sein kann. Über das Laufen, eine der wenigen natürlichen Bewegungsarten, die uns in einer – aus Steinzeitsicht – völlig aus den Fugen geratenen Zivilisation noch bleiben, kann das Individuum gewissermaßen einen Bezug zu seiner phylogenetischen2 Entwicklungsgeschichte herstellen. Für seine Vorfahren waren über große Zeitspannen hinweg mit der Mobilität Verhaltensweisen verbunden, die ihnen ihr Leben und Überleben sicherten.
Die meisten Menschen bewegen sich heutzutage zu wenig aktiv. Eine Folge dieser „chronischen Unterforderung“ ist, so der Diplom-Psychologe Thilo Spahl in seinem Buch „Die Steinzeit steckt uns in den Knochen – Gesundheit als Erbe der Evolution“, dass die Muskulatur schlaff wird und sich verkürzt. Daraus entwickelten sich Fehlhaltungen und damit verbunden Schmerzen. Weiterhin stellt er fest: Die im Sitzen ausgeübte Büroarbeit hat nachteilige Auswirkungen auf die Lendenwirbel. Normalerweise erleichtern diese den aufrechten Gang. Zum längeren Sitzen seien sie jedoch nicht eingerichtet. Das Tragen von Schuhen (eine sehr junge Erfindung in der Evolution) führe langfristig dazu, dass die Fußmuskulatur schwach wird. Die Folge sind Plattfüße.

Der „Siegeszug“ des Homo sapiens: Die zu erbringenden Opfer werden uns erst allmählich bewusst (im Bild: Ausbreitungsgebiet des heutigen Menschen mit ungefährer zeitgeschichtlicher Einordnung bzw. in Unterscheidung zu anderen Hominiden, Bildquelle: Wikimedia Commons)
Auch der Stoffwechsel des Menschen ist auf Bewegung angewiesen. Werden unsere Muskeln nämlich nicht beansprucht, nehmen sie keine Glucose (Traubenzucker) mehr aus dem Blut auf. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel in den Gefäßen an. Um den Glucosegehalt zu senken, produziert die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin. Ist dessen Ausschüttung zu hoch, können die Körperzellen dagegen resistent werden. Dadurch gerät wiederum der Glucosestoffwechsel außer Kontrolle, so dass sich Diabetes mellitus entwickeln kann.
Bei der heutigen Lebensweise werden uns unsere steinzeitlichen Prädispositionen geradezu zum Verhängnis. In welch engem Zusammenhang Bewegung und Ernährung stehen, erläutert die Ärztin Luzie Verbeek, die über Evolutionsmedizin3 promoviert hat: „Für unsere frühen Vorfahren war es sinnvoll, bei einer nahrungsreichen, großzügigen Umwelt selbst körperlich mal Energie zu sparen, sich also nicht zu verausgaben. Und wenn Nahrung da war, dann sollte sie sofort gegessen werden.“4 In Wohlstandsgesellschaften führt das hohe und jederzeit verfügbare Nahrungsangebot allerdings schnell zu Übergewicht. Dabei spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle: fehlender aktiver Bewegungsdrang, wie schon erwähnt, sowie einseitige kohlenstoffhydrat- und fettreiche Ernährung. Die Folgen sind auch hier Diabetes mellitus, zudem Herz-Kreislauf-Probleme und Gelenküberlastungen.
Der „sparsame Genotyp5“
Mit dem Phänomen „Zivilisationskrankheiten“ (ein Ausdruck des Konfliktes zwischen der Lebensweise des modernen Menschen und der unserer frühzeitlichen Vorfahren) hat sich der Anthropologe Robert Neel bereits 1962 im Hinblick auf unsere Ernährung beschäftigt. Seiner Hypothese nach, der des „sparsamen Genotyps“, folgend sind wir von unserer Stammesgeschichte her an ein „Top-und-Flop-Leben“ bestens angepasst, nicht jedoch an eines in permanentem Überfluss. Der Paläontologe Neil Shubin bestätigt ihn: „Als Jäger und Sammler erlebten die Frühmenschen einerseits Zeiten des Überflusses, in denen es viele Beutetiere gab und die Jagd oft zum Erfolg führte. Doch diese Phasen wurden andererseits von Zeiten des Mangels unterbrochen, in denen unsere Vorfahren bedeutend weniger zu essen hatten. Nach Neels Hypothese hat dieser Wechsel von Überfluss und Hunger seine Spuren in unseren Genen wie auch in unseren Krankheiten hinterlassen. Im Wesentlichen lautet seine Annahme: Der Organismus unserer Vorfahren konnte in Zeiten des Überflusses einen Vorrat aufbauen und in Hungerphasen darauf zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund ist die Fettspeicherung etwas sehr Nützliches. Nahrungsenergie wird so eingeteilt, dass ein Teil unsere derzeitige Aktivität antreibt, während ein anderer zum späteren Verbrauch gespeichert wird – zum Beispiel in Form von Fett. In einer Welt mit Mangel und Überfluss funktioniert ein solches System sehr gut, aber wenn ständig Nahrung in großer Menge verfügbar ist, versagt es kläglich. Dann sind Fettsucht und die mit ihr verbundenen Krankheiten – Altersdiabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten – eine ganz natürliche Folge.“
Fast Food: Schrumpfkost für die Zähne
Unsere frühzeitlichen Vorfahren mussten hohe Kaukräfte entwickeln, um ihre Nahrung im Mundbereich vorverdauen zu können. Wie sich an Schädeln von Homo sapiens neanderthalensis („Neanderthaler“), Homo erectus und anderen prähistorischen Hominiden6 belegen lässt, wurde dieser aufwändige Vorgang durch Überaugenwulste und stark gewölbte Jochbögen, an denen Muskelstränge ansetzten, unterstützt. Die Kauarbeit regte das Kieferwachstum an. Dadurch wurde für die Zähne ausreichend Platz geschaffen.
Dauernder Konkurrenzkampf im Betrieb, anhaltender Druck von oben und stete Angst vor dem Wegfall des Arbeitsplatzes sind uns Menschen stammesgeschichtlich fremd
Als die Vertreter des anatomisch modernen Menschen (taxonomische Bezeichnung Homo sapiens sapiens7) begannen, die Nahrung außerhalb des Körpers zu zerkleinern und durch Wärmebehandlung zu „zerkochen“ (thermische Denaturierung), fielen die mechanischen Reize aus. Somit schrumpften die Kiefer, und die Zähne fanden immer weniger Platz. Dieser Vorgang der Schrumpfung des Kauapparates ist vor etwa 10.000 Jahren allmählich eingeleitet worden, evolutionär gesehen ein eher kurzer Zeitraum. Fast Food und industriell hergestellte Nahrungsmittel fördern diese Entwicklungstendenz. Dass unser Kiefer nur noch bedingt belastbar ist, macht das Kaugummikauen für jeden erfahrbar. Nach einer gewissen Zeit spüren wir Muskelverspannungen und Schmerzen in den Kiefergelenkbereichen.
Dünnere Beinknochen – aber nicht mehr so belastbar
Auch an unseren Beinknochen lassen sich Veränderungen nachweisen. Der Amerikaner Christopher Ruff (School of Medicine, Baltimore) hat 100 fossile Beinknochenfunde von Hominiden aus den vergangenen zwei Millionen Jahren der Menschheitsgeschichte geröntgt. Seine Untersuchungen ergaben, „dass ihre Stärke bis zum Ende der Steinzeit, also etwa 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, um 15 Prozent abgenommen hat. Doch mit dem Beginn der Zivilisation beschleunigte sich das Schrumpfen. ‚In den letzten 4000 Jahren reduzierte sich die Knochenstärke um 15 Prozent – also um den gleichen Wert, für den vorher fast zwei Millionen Jahre benötigt wurden’, erläutert Ruff.“8 Dies zeigt: Der Mensch ist sozusagen „im evolutionären Schnelldurchlauf“ hinsichtlich seines Skelettes graziler geworden. Die dünneren Beinknochen müssen dafür viel mehr Fettmasse tragen als früher. Probleme sind vorprogrammiert.
Häusliche Hygiene ja – aber in Maßen
Unser Immunsystem ist heutzutage in gewisser Weise unterfordert. Thilo Spahl erklärt dies folgendermaßen: „Natürlich lebte der Mensch früher in sehr viel weniger hygienischen Verhältnissen. Unser Körper ist daher (…) auf die Koexistenz mit allerlei Parasiten ausgelegt. Dass diese heute fehlen, weil wir in der Lage sind, uns vor ihnen zu schützen, und dass wir auch weniger mit vielen anderen Mikroorganismen zu tun haben, stellt unser Immunsystem vor Probleme.“9 Konkret, so Spahl, komme es häufiger zu Über- oder Fehlreaktionen des Immunsystems und damit zu Allergien und anderen Autoimmunerkrankungen.
Nach Ansicht der amerikanischen Anthropologin Kathleen Barnes von der John Hopkins University, Baltimore, hängt die starke Zunahme von Autoimmunerkrankungen auch damit zusammen, dass wir einen Gast verloren hätten, der viele Jahrhunderte lang in unserem Darm lebte, als wir noch überwiegend auf dem Land lebten: nämlich den Pärchenegel. „Dieser Parasit animierte damals das Immunsystem zur Produktion von Abwehreinheiten, die nicht nur vor dem Wurm, sondern auch vor überschießenden Immunreaktionen schützten. Jetzt ist der Wurm infolge der veränderten, urbanen Lebensumstände aus unseren Gedärmen verschwunden, und dem Immunsystem fehlt dadurch eine wichtige Korrekturinstanz.“10
Die Angst vor der Angst
Der Mensch von heute muss sich kulturtechnischen und weltwirtschaftlich bedingten Umweltfaktoren gegenüber anpassen, für die er nicht angepasst ist. So etwa ist er nicht disponiert, unter permanentem repressiven Druck zu stehen. Dauernder Konkurrenzkampf im Betrieb, anhaltender Druck von oben und stete Angst vor dem Wegfall des Arbeitsplatzes sind uns Menschen stammesgeschichtlich fremd. Angst, in jeder Form, reduziert sich bei genauer Betrachtung auf eine Furcht vor Verlust von Kontrolle, und es ist nicht zu leugnen, dass sich Existenzangst nachteilig auf das Individuum und die Gesellschaft auswirkt.
Das menschliche Streben nach Anerkennung ist ein altes Primatenerbe
Das Schlimmste an der Angst jedoch ist die Angst vor der Angst. Biologisch betrachtet erfüllt Angst die Funktion eines universellen Warnsystems, eines Alarmsignals bei Gefahren: Sie macht in Sekundenbruchteilen den Körper kampf- oder fluchtbereit (Kampf-oder-Flucht-Reaktion, fight or flight response).11 Bevor die Bedrohung bewusst wird, lösen Botenstoffe aus dem Gehirn und das Hormonsystem ein Alarmsystem aus. Stoffe wie Acetylcholin und Noradrenalin bringen Atmung, Kreislauf, Muskulatur und Stoffwechsel auf Hochtouren. Angststörungen zählen jedoch mittlerweile zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Gleichzeitig, so paradox es klingen mag, wird Angst auch als eine „Triebfeder der Evolution“ und als Impuls für die Entwicklung der menschlichen Kultur angesehen.
Der Jäger auf der Überholspur
Auch das menschliche Streben nach Anerkennung ist ein altes Primatenerbe.12 Damit erfüllt die Zurschaustellung des Autos für den Einzelnen eine wichtige Funktion. Die Größe und Leistungsfähigkeit (Schnelligkeit) eines Fahrzeugs lässt sich für jeden Mitmenschen erkennbar mit dem Preis verbinden. Eine zusätzliche Luxusausstattung erlaubt es dem Besitzer, seinen Reichtum sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Wer über Geld verfügt, hat Macht. Der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt drückt es so aus: „Geld ist nichts anderes als ein Berechtigungsausweis auf die Arbeitsleistung anderer Menschen.“13

Steinzeitpsyche versus digitales Zeitalter: Die Grenzen unserer Belastbarkeit resultieren aus unserer Stammesgeschichte (Bildquelle: Wikimedia Commons)
Dass der Mensch den Umgang mit dem Vehikel alles andere als beherrscht, beweist der Alltag in vielerlei Hinsicht: Im Auto bewegen wir uns anonym; die anderen Verkehrsteilnehmer sind uns nicht bekannt. Zudem haben wir ihnen gegenüber eine gegnerische Einstellung (agonistisches Verhalten; agon, gr.: Wettkampf): Werden wir überholt, empfinden wir es als einen Angriff auf die eigene Person. Werden wir aufgehalten, reagieren wir ebenfalls aggressiv14. In diesem Moment können beschwichtigende Verhaltensweisen ihre Wirkung nicht mehr entfalten. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden oft als Mitmenschen gar nicht wahrgenommen.
In dieser Richtung argumentiert auch der Philosoph Peter Sloterdijk. Für ihn ist das Auto nicht nur Transportmittel, sondern ebenso „Rausch- oder Regressionsmittel“. Es sei vergleichbar mit einem rollenden Uterus, der sich von seinem biologischen Vorbild dadurch vorteilhaft unterscheidet, das er mit Selbstbeweglichkeit und Autonomiegefühlen verbunden ist. „Daneben gibt es auch phallische und anale Komponenten am Auto“, so Sloterdijk weiter, z. B. „das primitiv-aggressive Konkurrenzverhalten, das Aufprotzen und das Überholen, bei dem der andere, der langsamere, fast wie beim Stuhlgang, zum abgestoßenen Exkrement gemacht wird.“15
Vom Jäger zum Gejagten
Unsere hochtechnisierte Welt ist durch ein Wechselspiel der Kräfte entstanden. Auf der einen Seite steht der Mensch mit seinem Drang, Neues zu entdecken und zu entwickeln, auf der anderen die sich rasant verändernde Umwelt mit ihren Herausforderungen an ihn. Dieser Spannungsbogen bewirkt zwangsläufig Stress16, wodurch im Körper des Betroffenen Alarmreaktionen ausgelöst werden. Während unsere steinzeitlichen Vorfahren die Möglichkeit hatten, solche Reaktionen in Angriff, Flucht oder körperliche Arbeit umzusetzen, verfälschen zivilisatorische Auflagen wie etwa gesetzliche Regelungen und Dienstvorschriften heute derlei instinktive Impulse oder lassen sie gar ganz verstummen. Dies hat weitreichende Konsequenzen: Durch „Mobilmachung“ und Nichtaktivität stauen sich nicht nur Energien an, die der Körper nicht so ohne weiteres wieder abbauen kann; es werden auch eine Vielzahl biochemischer Prozesse unnütz gestartet.
Die Anonymität der Großstädte ist für das Sozialwesen Mensch neu
Welche Auswirkungen können Dauerstress mit einhergehendem Energiestau für den Körper haben? Ganz zuvorderst hat es Auswirkungen auf die Plastizität des Gehirns, was zu Depressionen („Burnout“), Angststörungen und Gedächtnisverlust führen kann. Stress schwächt bekanntermaßen auch das Immunsystem – mit der Folge erhöhter Infektionsgefahr. In den Blutgefäßen können Stresshormone Prozesse auslösten, die Arteriosklerose und Herzinfarkte begünstigen. Auch Heißhunger ist nicht selten stressbedingt. Werden Essgelüste zur Gewohnheit, kann sich, bei zusätzlichem Bewegungsmangel, Fett ansetzen. Es verwundert also kaum, dass Adipositas (Fettsucht) in Industrieländern signifikant zunimmt. Dort, wo sich die Zivilisation am weitesten von seiner gewohnten Disposition entfernt hat, wird unser Unvermögen im Umgang mit dem Übermaß an Stress und der Reizüberflutung am deutlichsten.
Die Mega-Urbanisierung – eine Entwicklung in die falsche Richtung
Der Trend der Verlagerung des Lebensraumes von ländlichen Gebieten in Städte lässt sich nicht mehr nur in Industrienationen beobachten, sondern längst auch in Entwicklungsländern. Einerseits ermöglichen urbane Zentren ihren Bewohnern in hohem Maße eine individuelle Gestaltungsfreiheit, vor allem dort, wo Wohlstand herrscht. Andererseits erzeugen wuchernde Riesenstädte (Megacitys) Struktur- und Orientierungslosigkeit, die zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der sozialen Kontakte und des seelischen wie körperlichen Wohlbefindens der Bewohner führen.
Die Anonymität der Großstädte ist für das Sozialwesen Mensch verhältnismäßig neu. Nach Ansicht Luzie Verbeeks haben die unüberschaubaren Gruppen in Städten und das dichte Zusammenleben mit zum großen Teil unbekannten Mitbürgern neben Einsamkeit und Depressionen noch andere Folgen: „Wir stehen nicht mehr nur mit Menschen, die wir persönlich kennen, im Wettbewerb – zum Beispiel bei der Partnersuche. Der Wettbewerb ist praktisch globalisiert worden.“17 Diese Entwicklung sieht Verbeek als enorme Herausforderung für das Gehirn. Denn je globalisierter ein Wettbewerb ablaufe, umso unüberschaubarer sei er, und umso schwieriger sei es auch, die eigenen Stärken zu erkennen – für sich selbst und von außen. Konkurrenzdruck ist heute an der Tagesordnung, eine Identitätskrise auch keine Seltenheit mehr.
Hat die Moderne noch eine Zukunft?
Dem Soziologen Hartmut Rosa zufolge ist es die Zeit selbst, die sich „entzeitlicht“. Die Menschen entscheiden nicht mehr unter dem Gesichtspunkt „zeitstabiler Werte“, sondern bestimmen ihre Handlungsziele „im Vollzug der Handlung, also in der Zeit selbst“. Seit dem Ende der 1980er-Jahre erweisen sich Nationalstaaten als eine Behinderung der globalen Beschleunigung, so Rosa. Sie seien hoffnungslos überfordert, die Ströme aus Geld, Handelswaren und Informationen zu synchronisieren. Für ihn gehe das Projekt der Moderne insgesamt zu Ende, denn es rechnet noch mit der gerichteten Zeit. Heute jedoch herrsche eine „richtungslose Dynamik“ vor und mache die Idee des Fortschritts zur Erinnerung. Nach Hartmut Rosa leben die Menschen im Zeitalter des simultanen Nebeneinanders von Despotie und Demokratie, Staatenbildung und Staatenzerfall, Kolonisierung und Entkolonisierung. Dass ein neues Gleichgewicht gelingt, hält er für unwahrscheinlich.
Nach Hartmut Rosa leben die Menschen im Zeitalter des simultanen Nebeneinanders von Despotie und Demokratie, Staatenbildung und Staatenzerfall, Kolonisierung und Entkolonisierung. Dass ein neues Gleichgewicht gelingt, hält er für unwahrscheinlich
Die gegenwärtige globale politische und wirtschaftliche Situation ist Anlass genug, um kritisch und skeptisch zu bleiben. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass unsere Politiker als Kurzzeitstrategen oder Wirtschaftsunternehmen das schon „irgendwie in den Griff“ bekommen. Kein Politiker kann intelligent genug sein, alle kommunalen wie globalen Probleme zeitgleich lösen zu wollen. In einer immer komplexeren und damit komplizierteren Welt verliert der Mensch von heute zunehmend die Übersicht und Kontrolle über seine Lebensbereiche. Sein „Steinzeitkörper“ ist schon längst an seine Grenzen gestoßen.
ANMERKUNGEN
- Epigenetik: Forschungsdisziplin, die sich u. a. mit der Vererbung von Verhaltensmustern jenseits der klassischen Biochemie befasst
- phylogenetisch: stammesgeschichtlich
- Der Begriff „Evolutionsmedizin“ (Evolutionary medicine oder Darwinian medicine) wurde u. a. von dem Ernährungswissenschaftler Loren Cordain eingeführt. In diesem Fachbereich erforscht man, wie der Körper des Menschen durch seine stammesgeschichtliche Herkunft geprägt worden ist.
- Zitiert nach Andrea Schorsch, 2011
- Genotyp: Gesamtheit der Gene eines Organismus („Anlagenbild“)
- Die Hominiden (Hominidae) stellen eine Familie der Primaten dar, in der die heute lebenden Gattungen der Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Menschen zusammengefasst werden. Paläontologisch gehören dazu außerdem die unmittelbaren Vorfahren des Menschen (Hominini) und die Vorfahren der anderen rezenten Gattungen.
- Dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nach ging der anatomisch moderne Mensch vor etwa 160.000 Jahren aus dem ostafrikanischen Homo erectus hervor. Demzufolge sind alle Menschen der Weltbevölkerung von ihrem genetischen Ursprung her Afrikaner.
- Zitiert nach Jörg Zittlau, 2011
- Zitiert nach Andrea Schorsch, 2011
- Zitiert nach Jörg Zittlau, 2011
- Durch die Nebennierenhormone Adrenalin und Noradrenalin wird der Körper auf eine Notstandssituation eingestellt, da eine gewaltige Anstrengung unmittelbar bevorzustehen scheint. Diese spiegelt sich im Angriffs- oder Fluchtverhalten wider. Die Ausschüttung dieser beiden Hormone wird nicht von der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) über Hormone, sondern vom Sympathikus veranlasst. Deshalb entfalten sie ihre Wirkung viel rascher.
- Als Primaten bezeichnet man die Ordnung der Säugetiere, zu der die Halbaffen, Affen, Menschenaffen und der Mensch gehören.
- Zitiert nach Irenäus Eibl-Eibesfeldt, 1988
- Als aggressiv bezeichnet man alle Verhaltensweisen, mit deren Hilfe ein Individuum oder eine Gruppe sein oder ihr Interesse gegen den Widerstand anderer durchsetzt.
- Zitiert nach „Der Spiegel“, Nr. 8, 1995, S. 130
- Stress charakterisiert das Syndrom physiologischer Anpassungen an unspezifische exogene („von außen wirkende“) und endogene („von innen kommende“) Faktoren.
- Zitiert nach Andrea Schorsch, 2011
LITERATUR
- Jörg Blech: Mensch und Evolution – Falsch konstruiert für die moderne Welt. Spiegel-Online-Interview vom 28.09.2009
- Loren Cordain et al.: Realigning our 21 Century Diet and Lifestyle with our Hunter – Gatherer Genetic Identity. In: Directions in Psychiatry, Vol. 25, 2005
- Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Der Mensch – Das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft. R. Piper, München 1988
- Thilo Spahl/Detlev Ganten/Thomas Deichmann: Die Steinzeit steckt uns in den Knochen – Gesundheit als Erbe der Evolution. Piper Verlag, München 2009
- Bernd Lötsch: Ist die Zukunft schon zu Ende? In: Funkkolleg Der Mensch – Anthropologie heute. Studienbrief 10
- Rolf W. Meyer: Der Affe im Anzug oder: Unser Leben im Alltagsdschungel. Pro Business, Berlin 2004
- Rolf W. Meyer: Unsere Zukunft liegt in der Vergangenheit oder: Lernen von unseren frühzeitlichen Vorfahren. Pro Business, Berlin 2006
- Rolf W. Meyer: Vom Faustkeil zum Internet – Die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Humboldt Verlag, Baden-Baden 2007
- Hartmut Rosa: Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 2005
- Andrea Schorsch: Die Steinzeit passte besser – Mensch lebt nicht mehr artgerecht, veröffentlicht auf n-tv.de am 31.03.2011
- Neil Shubin: Der Fisch in uns: Eine Reise durch die 3,5 Milliarden Jahre alte Geschichte unseres Körpers. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2008
- Jörg Zittlau: Der moderne Mensch ist eine biologische Baustelle, veröffentlicht auf Welt online am 26.03.2011
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems