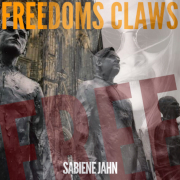zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Welche Erkenntnisse wir aus der menschlichen Stammesgeschichte für eine nachhaltige Politik gewinnen sollten (Update)
- Mittwoch, 08. Januar 2020 17:25
Die verkannte Evolution
Von ROLF W. MEYER
Trotz mahnender Worte zahlloser Experten und deutlichen Anzeichen kulturellen Niedergangs gehen wir Menschen – Lemmingen gleich – den Weg Richtung Abgrund beharrlich weiter. Warum tun wir das? Weil wir unter den gegebenen Voraussetzungen nicht anders können, meint Buchautor Rolf W. Meyer. Im Text liefert er die entsprechenden Belege – und Lösungswege aus dem Dilemma gleich mit. Die Erstfassung dieses Beitrags erschien im Dezember 2010. Der Artikel wurde vom Autor zwischenzeitlich dem neuesten Wissenstand angepasst und nun auf zeitgeist Online unter gleichem Titel neu veröffentlicht.
|
„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“ Charles R. Darwin „Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit übertrifft. Auf der Welt wird es nur noch eine Generation aus Idioten geben.“ Albert Einstein |
Im weitaus größten Zeitraum seiner Stammes- und Kulturgeschichte lebte der Mensch ausschließlich als Jäger und Sammler in überschaubaren Sozialverbänden. Seit der Sesshaftigkeit in der Jungsteinzeit hat er seine natürliche Umwelt tiefgreifend umgestaltet. Unser Alltagsleben wird heutzutage von hochentwickelter Technik und in immer stärkerem Maße von „megaurbanen“ Regionen geprägt. Die schnelle kulturgeschichtliche Entwicklung, besonders im Zeitalter der profitorientierten Globalisierung, stellt die Weltbevölkerung jedoch vor gewaltige Probleme. Denn der menschliche „Steinzeitkörper“ hat sich an die Herausforderungen der modernen Zivilisation kaum anpassen können. Mit diesem Problem hätte sich die Politik weltweit längst auseinander setzen müssen. Anhand von 12 Thesen soll im Folgenden aufgezeigt werden, wie wirklich fruchtbaren Lösungen aussehen könnten, die unseren stammesgeschichtlichen Wurzeln, und damit Mensch und Natur, gerecht werden.
Über 7,6 Milliarden Menschen bevölkern bereits heute unseren Planeten. Und täglich werden es rund 230.000 mehr. Die Fruchtbarkeit des modernen Menschen ist noch immer so hoch, dass schon in wenigen Jahrzehnten ein Bevölkerungskollaps droht, wenn die heutigen Verhältnisse unverändert in die Zukunft hinein verlängert werden. Auch andere Bedrohungen machen uns Menschen zu schaffen, so etwa die immer wieder aufkeimenden gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Völkern, oder auch die durch Klimaveränderungen und das sich verschärfende wirtschaftliche Ungleichgewicht zu erwartenden Migrationen.
Von den rezenten Menschen gibt es auf der Erde nur eine Unterart, nämlich den Homo sapiens sapiens. Diese Tatsache widerlegt im Übrigen die von Politikern, Ideologen und manchen Wissenschaftlern immer wieder vertretene Auffassung von existierendem Rassismus. Dieser Begriff impliziert nämlich die Vorstellung, dass es sich bei den Menschen um verschiedene Rassen handelt. Dies aber entbehrt jeder biologischen Grundlage.
Der Begriff „Rassismus“ impliziert die Vorstellung, dass es sich bei den Menschen um verschiedene Rassen handelt. Dies aber entbehrt jeder biologischen Grundlage
Immer wieder wird uns vor Augen geführt, wie extrem verwundbar unsere hochkomplexe, moderne Zivilisation ist, die überwiegend auf wirtschaftliche Dynamik ausgerichtet ist und geradezu blindgläubig auf die Allmacht moderner Technik vertraut. Doch damit lassen sich unsere weltumgreifenden Probleme nicht lösen, im Gegenteil, sie werden dadurch nur noch verstärkt. Um den kommenden gesellschaftspolitischen Entwicklungen besser begegnen zu können, ist ein Umdenken im Hinblick auf sozialpolitische Langzeitstrategien erforderlich. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich auch Politiker intensiv mit der Humanevolution auseinandersetzen.
These 1: Alle Menschen sind auf Grund der biologischen Evolution ihrer Vorfahren und einer kulturellen Prägung verschieden und verfügen damit auch über unterschiedliche Fähigkeiten
Obwohl die Evolution naturwissenschaftlich als Faktum gilt, reden und schreiben viele Politiker, Philosophen, Pädagogen und Soziologen an diesem Wissensfundus vorbei und lehren ihre politischen Programme bzw. ihre wissenschaftlichen Disziplinen so, als habe Charles Darwin (1809–1882), der Begründer der Selektionstheorie, nie existiert. Die genannten Personenkreise gehen unbeeindruckt davon aus, dass der Mensch ein Sonderfall ist, und weisen evolutionsbiologische, ethnologische sowie soziobiologische Erklärungen für das Verhalten des Menschen entschieden zurück.

Dauerhaft im Glücksrausch? Darauf ist der Mensch von seiner Stammesgeschichte her nicht programmiert (Bildquelle: David Boyle/Wikimedia Commons)
Wissenschaftlich ist belegt, dass beispielsweise Menschenaffen und Menschen eine Reihe von Ähnlichkeiten aufweisen, die eine direkte Folge der engen genetischen Verwandtschaft aufgrund der gemeinsam durchlaufenen Stammesgeschichte sind. Nicht nur die meisten körperlichen Merkmale von Primaten, auch viele ihrer Verhaltensweisen sind Ergebnisse einer phylogenetischen Anpassung. Im Vergleich von Menschen und Schimpansen zeigt sich dies beispielsweise im Imponiergehabe und in der Bildung einer Troika – einer Form der politisch motivierten Kooperation zum Machterhalt innerhalb von Sozialverbänden. Das bedeutet, dass der Mensch körperlich, sozial-emotional und geistig als Produkt der Primatenevolution zu begreifen ist. Wenn wir die Entwicklungsphase der Vormenschenformen, zu denen auch die „Südaffen“ (Australopithecinen) zählen, mit einbeziehen, begann die Entwicklungsgeschichte der Homini vor etwa sieben Millionen Jahren. Nebenbei bemerkt: Die erste Menschenart hat sich nach gegenwärtiger Erkenntnis vor 2,5 Millionen Jahren in Ostafrika entwickelt, der sogenannte Homo rudolfensis.
Bis vor etwa 10.000 Jahren, also während rund 99,6 % der Menschheitsentwicklung, lebten unsere frühzeitlichen Vorfahren ausschließlich als Jäger und Sammler. Man kann davon ausgehen, dass sie an diese Art der Lebensweise gut angepasst waren. Danach entwickelten sich mit Übergangsphasen der Semisesshaftigkeit Pflanzer- und Hirtenkulturen. Vorratswirtschaft und Tauschhandel bedingten und ermöglichten das Zusammenleben vieler Menschen auf kleinem Raum, nämlich in einem Dorf, und später in der Stadt. Mit der industriellen Revolution, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann, wurde die Entstehung von Großstädten und in der Folge eine wahre Bevölkerungsexplosion ermöglicht. Damit ist zwar die Umwelt des Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum völlig verändert worden, nicht aber sein Erbgut. Im Zeitalter der Computertechnik, also im Informationszeitalter, denken, fühlen und handeln wir noch immer mit einer „Steinzeitpsyche“.
Im Zeitalter der Computertechnik denken, fühlen und handeln wir noch immer mit einer „Steinzeitpsyche“
Eindrucksvoll ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass die wichtigste Überlebens- und Entwicklungsleistung unserer frühzeitlichen Vorfahren nicht in der Suche nach Nahrung und nicht in der Abwehr von Naturgewalten sowie von wilden Tieren bestand, sondern in der erfolgreichen Auseinandersetzung mit der größten aller Herausforderungen: dem Zusammenleben mit anderen Menschen! Wenn es ein „Markenzeichen“ des Homo sapiens sapiens gibt, dann ist es die hochentwickelte Fähigkeit zur Kooperation. Daran ändern auch „Phänomene“ wie Krieg, Unterdrückung und Ausbeutung nichts. Diese Erscheinungen machen nicht das eigentliche Wesen des Menschen aus. Vielmehr sind sie Folgen pervertierter oder misslungener Kooperation. Es gibt, nicht nur genetisch betrachtet, mehr Gemeinsamkeiten zwischen Menschen als Unterschiede. Wir alle haben die gleiche psychische Grundausstattung und sind deshalb auch zu gegenseitigem Verständnis und zur Zusammenarbeit fähig. Sowohl unsere geistigen Fähigkeiten als auch die enge genetische Verwandtschaft der Menschen untereinander sind zurückzuführen auf die Zeit unserer Vorfahren in Afrika. Der anatomisch moderne Mensch entwickelte sich vor etwa 300.000 Jahren in Afrika. Genetisch betrachtet sind wir also alle Afrikaner.
Ein Phänomen moderner Gesellschaftsformen sind Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen. Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Humanethologie und Anthropologie tragen entscheidend dazu bei, dass der Mensch sich selbst, seine Mitmenschen und soziale Beziehungen besser versteht. Es ist daher zwingend erforderlich, dass humanethologische und anthropologische Einsichten in pädagogische Programme mit einbezogen werden und in Institutionen wie Kindergarten und Schule konsequent Anwendung finden. Man sollte wissen: Alle Menschen sind als Individuen biologisch betrachtet ungleich. Dies hat seine Ursache nicht nur in einer jeweils anders gestalteten Umwelt, sondern auch in unterschiedlicher Genausstattung. Bildungspolitiker und -institutionen müssen davon ausgehen, dass diese Ungleichheit nicht durch Angleichung der konkreten schulischen Situation zu beseitigen ist. Aufgabe der Schule hat es zwar zu sein, allen Schülern gleiche Startbedingungen zu schaffen. Jedoch zu meinen, dass nach Schaffung dieser Bedingungen (Einheitsschule!) alle das gleiche Ziel erreichen, verkennt die Realität. Denn eine so konzipierte Schule führt dazu, dass viele Schüler permanent überfordert, ein anderer Teil in der Leistung unterfordert wird. Beides, Über- wie Unterforderung, kann negative Folgen mit sich bringen.
Ein weiterer Aspekt: Damit Kinder nicht ständig unter sozialem Stress stehen, benötigen sie überschaubare und individualisierte Gruppen. Der Mensch ist schließlich von Natur aus ein Individual- und Sozialwesen und aufgrund seiner Stammesgeschichte an ein Leben in überschaubaren Gruppen angepasst. Anonymität als Folge zu großer Sozialverbände könnte mit Ursache dafür sein, dass heutzutage die Anzahl verhaltensauffälliger Schüler steigt. Daraus ergibt sich die Forderung nach nicht zu großen Schulsystemen, wie z. B. Gesamtschulen oder Schulzentren, sowie danach, Klassen- bzw. Oberstufenkursverbände, die nicht überdimensioniert sind, möglichst beizubehalten. Das Schulkind und der Jugendliche fühlen sich am wohlsten, wenn sie mit Menschen Umgang haben, zu denen ein persönlicher Bezug hergestellt werden kann. Da jede Klasse bzw. jeder Oberstufenkurs ein strukturierter individueller Sozialverband mit ausgebildeter Rangordnung ist und daher auch Über- bzw. Unterordnungsbereitschaft voraussetzt, kann auf Autorität (basierend auf dem eigenen Vorbild!) nicht verzichtet werden. Befehlspädagogik ist aber ebenso abzulehnen wie eine antiautoritäre Erziehung.
Damit Kinder nicht ständig unter sozialem Stress stehen, benötigen sie überschaubare und individualisierte Gruppen
Dass die Aggressivität schon im Kindesalter zunimmt, hat eine Reihe von Ursachen, die in Familie und Gesellschaft begründet liegen. So etwa die Verunsicherung der Jugend, die heute nicht mehr auf einen Bestand verlässlicher Normen, Werte und Traditionsbezüge zurückgreifen kann. Da die Verschlechterung beim sozialen Verhalten erst mit zunehmendem Wohlstand eingetreten ist, sind vorrangig Umwelteinflüsse maßgebend: Arbeitslosigkeit und Verstädterung, aber auch Vernachlässigung der primären emotionalen Bedürfnisse der Kinder. Dies betrifft das Eingebundensein in eine Familie, eine intakte Mutter-Kind-Beziehung, emotionale Zuwendungen und als weiterer Faktor das Gewähren eines Übermaßes an Freiheit. Die schulische Freiheit, die zum Lernen eingeräumt wird, hat zur Folge, dass den Schulkindern nicht nur Grundkenntnisse fehlen, sondern sie auch nicht in der Lage sind, regelmäßig und gewissenhaft zu arbeiten. Das Phänomen „explorative Aggression“ bei Kindern und Jugendlichen ist eine Reaktion darauf, dass ihnen vonseiten der Erwachsenen nicht in hinreichendem Maße Grenzen aufgezeigt werden.
These 2: Phänomene wie Xenophobie (Fremdenscheu), militante Territorialität und Nepotismus (Vetternwirtschaft) gehören zu den Universalien des menschlichen Verhaltens
Fremdenscheu lässt sich aus unserer Stammesgeschichte her erklären; sie ist tief in unserer sozialen Evolution verwurzelt. Der Ethnozentrismus, d. h. die Überhöhung des eigenen Volkes, der eigenen Kultur, und militante Territorialität sind, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, bei praktisch allen Gesellschaften anzutreffen. Solche Feststellungen werden gerade heutzutage, da das Ausländer- und Asylantenproblem in vielen Ländern aktuell geworden ist, häufig missverstanden. Zieht man die einzelnen Bedingungen in Betracht, unter denen die Homininen der Altsteinzeit (Paläolithikum) gelebt haben, dann wird man verstehen, warum die Kleingruppe erfolgreich war: Die Nutzung der Ressourcen war besser möglich, wenn mehrere Individuen miteinander kooperierten, als durch eine individuelle Jagd. Die Jagd- und Sammelmöglichkeiten in einem bestimmten Areal begrenzten aber die Zahl derer, die ernährt werden sollten. Gruppenfremde Individuen waren daher nicht erwünscht. Heute haben wir zwar längst ein Stadium erreicht, das uns ein Miteinander von Völkern und unterschiedlichen Kulturen erlaubt, doch spielen uns unsere stammesgeschichtlichen Verhaltensrelikte immer wieder Streiche.
Wenn es ein „Markenzeichen“ des Homo sapiens sapiens gibt, dann ist es die hochentwickelte Fähigkeit zur Kooperation
Tatsache ist, dass es innerhalb der einzigen auf der Erde lebenden menschlichen Unterart phänotypische Variationen des Homo sapiens sapiens gibt. Es handelt sich um sogenannte geographische Populationen, die sich in der Häufigkeit ihrer Allele – spezifischer Ausführungen von Genen – unterscheiden. Daraus darf aber nicht auf die Ungleichwertigkeit der Menschen geschlossen werden. Wer das Gegenteil behauptet, muss sich schon den Vorwurf gefallen lassen, nichts anderes als politischen Einfluss gewinnen zu wollen. Nebenbei bemerkt: Die durchschnittlichen Unterschiede zwischen einzelnen geographischen Populationen sind geringer als die individuellen Unterschiede innerhalb der jeweiligen Population.

Ein Übermaß an Hingabebereitschaft ist kriegsfördernd (Bildquelle: Susan Norvick, Department of Defense Civilian/Wikimedia Commons)
Im konkreten Fall des Problems der Fremdenscheu darf nicht übersehen werden, dass allen menschlichen Gesellschaften ein Wir-Gefühl eigen ist, das dem Einzelnen Identität mit der Gruppe vermittelt. Dieses Wir-Gefühl jedoch schließt gleichsam automatisch die Diskriminierung aller andersartigen Mitmenschen mit ein. Diese Diskriminierung muss nicht gleich Hass und Feindschaft bedeuten, kann sich aber, z. B. bei Ressourcenknappheit, sehr wohl dahin steigern. Das unterscheidet den Menschen in der heutigen Massengesellschaft nicht vom Jäger und Sammler auf steinzeitlichem Niveau. Die Universalität von Wir-Gefühl und Diskriminierung legt nahe, dass damit stammesgeschichtlich alte, genetisch bedingte Neigungen vorliegen. Statt diese zu leugnen, sollten wir uns bemühen, mit ihnen so zu leben, dass Exzesse vermieden werden können.
Eine Erscheinung, die uns in Großgesellschaften besondere Schwierigkeiten bereitet, ist der Nepotismus, auch „Vetternwirtschaft“ genannt. Juristen zerbrechen sich darüber offensichtlich den Kopf. Schließlich weiß man, dass überall die Tendenz besteht, durch nepotistisches Verhalten, in besonderem Maße Politik und Wirtschaft, zu beeinflussen (Stichwort Lobbyismus). Um persönliche Vorteile erzielen zu können. muss man auf Verwandte und Freunde zählen können. Zudem ist es vorteilhaft, wenn mehrere von ihnen auf verschiedenen, möglichst einflussreichen Posten sitzen. Das „Prinzip der vernetzten Beziehungen“ (Franz M. Wuketits 1997) war schon immer für Angehörige von Kleingruppen selbstverständlich. Von gesetzgebenden Instanzen wird es hingegen mit dem Begriff „Korruption“ gekennzeichnet und verfolgt. Damit entsteht ein Grundsatzkonflikt zwischen der menschlichen Natur und den Erfordernissen der Kontrolle in Massengesellschaften. Dieser Konflikt ist nur ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit unserem stammesgeschichtlichen Erbe nicht ohne weiteres zurechtkommen. Der Gesetzgeber müsste einsehen, dass er nepotistisches Verhalten erst recht fördert, wenn er es rigoros bekämpft. In parlamentarischen Demokratien werden Gesetze im Parlament beschlossen. Dort gibt es Fraktionen und Seilschaften sowie Absprachen unter den Abgeordneten, was bedeutet, dass selbst ein Gesetz gegen Nepotismus letzten Endes auf nepotistischem Verhalten beruht. Dies offenbart seinerseits jene Politik, die unsere biologischen Verwandten, z. B. die Schimpansen, hervorragend anzuwenden verstehen. Es wäre also völlig falsch, unsere Neigung zu nepotistischem Verhalten als grundsätzlich schlecht abzutun. Der Nepotismus hat, um es noch einmal hervorzuheben, eine wichtige Funktion: Für die Angehörigen von Kleingruppen ist er lebensnotwendig.
These 3: Menschen neigen dazu, Sympathiegruppen zu bilden
Im Nachhinein betrachtet war nicht das Auftreten von nepotistischem Verhalten in der Evolution ein Fehler, sondern die Bildung von Massengesellschaften. Aber dieser Prozess ist unumkehrbar. Was daher als wichtige Aufgabe für Politiker, Juristen, Städteplaner und Erzieher zu formulieren wäre, ist die Berücksichtigung der menschlichen Tendenz, Sympathiegruppen zu bilden: kleine soziale Einheiten, die dem Einzelnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Der Bau riesiger Wohnblocks in unseren Städten und Großstädten, in denen Hunderte oder Tausende von Menschen wohnen, geht in die verkehrte Richtung, auch wenn man von einer scheinbar hohen Anpassungsfähigkeit des Menschen ausgeht. Denn Lebensbereiche, die nicht unserer biologischen Disposition entsprechen, sondern willkürlich gestaltet sind, können sich für jeden Menschen nachteilig auswirken.
These 4: Das soziale Verhaltenspotenzial des Menschen muss stärker genutzt werden
Ein besonderes Merkmal des Menschen ist seine soziale Intelligenz, die sich beispielsweise auch bei unseren genetischen Verwandten Bonobos, Schimpansen und Gorillas zeigt. Die meisten Menschenaffen und andere nichtmenschliche Primaten, wie etwa Paviane und Rhesusaffen, leben in eng geknüpften sozialen Verbänden, in einem Geflecht von Allianzen, Freundschaften und Rangordnungen. Das Gruppenleben ist geprägt von Intrigen und Konflikten, aber auch von Zuwendung, Geselligkeit, Kooperation und wechselseitiger Unterstützung. Was uns beim Beobachten von Affen so amüsant und wie eine ferne, primitive Version unserer eigenen Existenz erscheint, hat sich im Laufe der menschlichen Entwicklung zu einem unglaublich komplizierten und ausdifferenzierten System sozialer Interaktionen entwickelt. Der Mensch ist vor allem das verhandelnde Wesen. Das Leben in sozialen Verbänden erzwang aber schon bei den Frühzeitmenschen ständige Wenn-Dann-Abwägungen, Rücksichtsnahmen, Absprachen, Rangordnungskämpfe, Kompromisse und Austausch sowie Gegenleistungen. Diese sozialen Kompetenzen sind das wichtigste soziale Erbe unserer Vorfahren.
Der moderne Mensch ist nicht daran angepasst, unter einem andauernden repressiven Druck zu stehen
Wie diese frühzeitlichen Vorfahren müssen auch wir Jetztmenschen Freundschaften schließen und Zweckallianzen eingehen. Wir bevorzugen die Nähe zu bestimmten Mitmenschen, wir organisieren nicht nur Arbeitsgemeinschaften und Vereine, sondern gründen auch Kartelle zum gegenseitigen Vorteil. Außerdem suchen wir immer wieder die Aufmerksamkeit und Anerkennung unserer Mitmenschen. Ein weiterer mentaler Mechanismus, der uns befähigt, die ungeheueren Komplexitäten des sozialen Zusammenlebens zu bewältigen, ist die universal verbreitete Fähigkeit, die Betrugsabsichten von Mitmenschen erkennen zu können. Der Mensch besitzt einen Sensor für Täuschungsversuche, er kann aufgrund von Mimik und Verhalten erkennen, ob ihn jemand reinlegen will. Diese scheinbar unwichtige Fähigkeit ist ein kognitives Programm, das in der Humanevolution offenbar einen besonderen Überlebenswert hatte. Die menschliche Intelligenz entwickelte sich also nicht als eine allgemeine, abstrakte Problemlösefähigkeit, sie stellt vielmehr ein ganzes Bündel spezifischer, parallel geschalteter Intelligenzen dar.
These 5: Ein Modell für die Zukunft ist die Kooperation zwischen Männern und Frauen
Nicht nur die Gegenwart, auch die Zukunft ist geprägt von einem gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Wandel, und zwar von der Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Derartige Veränderungen lassen sich nur durch Strategien auf der Grundlage männlicher und weiblicher Kompetenzen wirksam meistern. Männer und Frauen müssen daher bereit sein, auf unterschiedlichen Gebieten hinzuzulernen. Vor allem, miteinander zu kooperieren. Was die Zusammenarbeit von Mann (ein Kurzzeitstratege) und Frau (eine Langzeitstrategin) betrifft, so treffen zwei immer noch unterschiedlich gepolte Denkorgane aufeinander. Denn männliches und weibliches Gehirn arbeiten verschieden und entwickeln Lösungsstrategien, die deutlich voneinander abweichen. Zu betonen ist, dass Männer und Frauen sich nicht im Grad, sondern in der Art ihrer Intelligenz unterscheiden. Der große Unterschied liegt in der spezifischen und anlassbezogenen kognitiven Leistung der Vertreter beider Geschlechter. Diese Unterschiede sprechen nicht gegen eine Teamfähigkeit von Mann und Frau. Im Gegenteil: Sie bieten die Chance einer gegenseitigen Ergänzung (Dorothea Assig 2001). Was schon unseren frühzeitlichen Vorfahren über Hunderttausenden von Jahren erfolgreich gelungen war, sollte für uns auch heute machbar sein. Der Gewinn wird viel versprechend sein: Der Aktionsspielraum und die Effizienz der Handlungen kann sich in vielen männlich dominierten Institutionen um ein Vielfaches erhöhen, wenn der Anteil kompetenter Frauen zunimmt. Und darauf hinzuarbeiten sollte für unsere Gegenwart und Zukunft ein erklärtes Ziel sein.

Eine „Steinzeitpsyche“ prägt den modernen Menschen noch heute (Bildquelle: Pixabay)
These 6: Der Mensch ist nicht unbegrenzt anpassungsfähig
Das Wort „Globalisierung“ beherrscht weite Teile der öffentlichen Debatte: über Veränderungen der Weltwirtschaft, über Strukturwandel, über Arbeitslosigkeit. Der Jetztzeitmensch muss sich kulturtechnischen und weltwirtschaftlich bedingten Umweltfaktoren gegenüber anpassen, für die er aber nicht immer geeignet ist. Die profitorientierte Globalisierung, deren tragende Säulen weltweite Handels- und Finanzmärkte, globaler Schiffs- und Flugverkehr sowie im Internet weltumspannend vernetzte Computersysteme darstellen, ist ein Prozess, der diese für den Menschen nachteilige Entwicklung weiter fördern wird. Der Homo sapiens sapiens ist nicht daran angepasst, unter einem andauernden repressiven Druck zu stehen. Das Unterordnen unter eine dominante Person ist in den Sozialverbänden der frühzeitlichen Jäger und Sammler normal gewesen. Es war sogar lebensnotwendig. Von einem Ranghöchsten ist jedoch erwartet worden, dass er Konflikte löst und so den Druck abbaut. Ständiger Konkurrenzkampf im Betrieb, Druck von oben und die dauernde Angst um den Arbeitsplatz, wenn man nicht mit Hochdruck arbeitet, sind in unserer Stammesgeschichte nicht eingeplant. Existenzangst wirkt sich jedoch nachteilig auf das Individuum und damit letztendlich auch auf die Gesellschaft aus. Nach Ansicht des Verhaltensforschers Irenäus Eibl-Eibesfeldt „infantilisiert Angst die Massen, macht sie beeinflussbar für Menschen, die eine einfache Lösung versprechen.“ Dies lässt sich immer wieder am Verhalten von Politikern beobachten. Dass Demagogen oft erst künstlich Angst erzeugen, um dann als Retter aufzutreten, ist kein Zufall.
Angst infantilisiert die Massen, macht sie beeinflussbar für Menschen, die eine einfache Lösung versprechen
Der Übergang von der sich selbst versorgenden Großfamilie zur arbeitsteiligen Millionen-Gesellschaft ist zwar die Voraussetzung für unsere heutige Kultur; sie bringt aber auch massive Probleme mit sich: Der anonymen Masse gegenüber siegt in der Regel die Rücksichtslosigkeit. Sollte die ökologisch-soziale Marktwirtschaft sich weiter in Richtung auf eine globale Freihandelswirtschaft entwickeln, wird das für die Beschäftigten verheerende Auswirkungen haben: mehr Anonymität, mehr Stress, mehr Angst. Als wichtige Rückzugsgebiete („emotionale Nischen“) bleiben Familie, Freundes- und Kulturkreise. Hier kann das Individuum sich in einen geschützten, vertrauten Bereich zurückziehen, Stress abbauen und wieder neue Kraft sammeln. Es ist jedoch zu befürchten, dass diese Rückzugsgebiete durch die profitorientierte Globalisierung und durch die damit verbundene hohe Mobilität bei vielen Menschen bedroht werden.
Welche weiteren Konsequenzen ergeben sich für die Weltbürger aus der profitorientierten Globalisierung? In immer stärkerem Maße werden die Begrenzungen der Nationalstaaten in Politik, Wirtschaft und Kultur überwunden. Multinationale Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Viele Kritiker dieser Entwicklung sehen in der wirtschaftlich geprägten Globalisierung einen möglichen Weg in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit Superreichtum bei wenigen und Verarmung sowie Ausgliederung bei vielen. Das entspräche einer 20:80-Gesellschaft (Hans-Peter Martin/Harald Schumann 1998). Was versteht man darunter? Nach Ansicht von Experten, darunter der US-amerikanische Ökonom und Soziologe Jeremy Rifkin sowie der deutsche Friedensforscher Horst Afheldt, reichen in naher Zukunft weltweit 20 % der arbeitsfähigen Bevölkerung aus, um mithilfe moderner Technologie wie etwa Künstlicher Intelligenz die Weltwirtschaft in Schwung zu halten. Die restlichen 80 % sind ihrer Meinung nach „wirtschaftspolitisch betrachtet im Prinzip überflüssig“. Allerdings müsse dieser hohe Anteil an arbeitsfähigen Menschen ausreichend ernährt und permanent unterhalten werden („Tittytainment“, eine Wortbildung aus englisch titty (Slang für Busen) und entertainment (Unterhaltung). Zugeschrieben wird dieser Begriff dem Geostrategen Zbigniew Brzezinski). Dieser gesellschaftliche Trend ist bereits in vollem Gang: Großveranstaltungen vermitteln auch in unserer heutigen Zeit den Teilnehmern „eine erlebte Zeitgenossenschaft“ (Philipp Holstein), wobei die „Events“ ein Gefühl der Zugehörigkeit erzeugen und eine Art von Geborgenheit in der Masse entstehen lassen. Auch daran zeigt sich: Den Menschen wird das Gefühl vermittelt, in einer zunehmend egalitären Gesellschaft ohne Klassengegensätze zu leben.
These 7: Es ist zwingend erforderlich, zur Lösung sowohl lokaler als auch globaler Probleme sozialpolitische Langzeitstrategien zu entwickeln
Die Grenzen unseres Erkenntnisapparates hat die Umweltzerstörung schon seit langem aufgedeckt: Beschränkungen der Denkfähigkeit, der Wahrnehmung, der Ursachenzuschreibung, ja selbst der Zeitperspektive. Letzteres relativiert jene Besonderheit, die in Anlehnung an den Psychologen und Systemtheoretiker Norbert Bischof als „Differentia specifica des Menschen“ herausgestellt werden muss: Allem Anschein nach gilt Zukunftsvergegenwärtigung nur für unser Denken, nicht jedoch für unser Handeln. Unser Umweltverhalten verweist auf eine weitere psychische Besonderheit des Homo sapiens sapiens, nämlich seine Illusionsneigung. Längst sind aus lokalen Umweltproblemen globale Umweltkrisen geworden. Wir aber bilden uns nach dem „Prinzip Hoffnung“ ein, dass es schon irgendwie weitergehen wird – mit verbesserter Technik. Eibl-Eibesfeldt kommt zu der richtigen Erkenntnis, wenn er als heutiges Problem „die Fallen der Kurzzeitstrategien“ hervorhebt. Das rational sicherlich als notwendig Erkannte lässt die Menschen erfahrungsgemäß unberührt, wenn die negativen Folgen ihres Handelns erst zwei Generationen später spürbar werden. Dieses Denkmuster lässt sich bei vielen politisch verantwortlichen Mitmenschen beobachten. Viele von uns werden es nicht glauben, aber „es gibt soziale Staaten, die von den Klügsten regiert werden. Das ist bei den Pavianen der Fall“ (Konrad Lorenz).
Für das unfertige Wesen Mensch wird in Zukunft lebenslanges Lernen die Norm sein
Damit ein Sozialverband heutiger politischer Größenordnung auf zukünftige Anforderungen besser reagieren kann, müssen seine ranghöchsten Vertreter zwingend über eine Reihe von Befähigungen verfügen. Dies sind vorrangig: hoher Sachverstand, vorausschauendes Denken, Erklärungskompetenz, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen. Es sind übrigens Anforderungen, die auch an Ranghöchste eines frühzeitlichen Sozialverbandes gestellt wurden! Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist der der Führung. Bei einer Führungskraft geht es keineswegs nur um das Problem der Kontrolle. Kontrollieren ist nicht führen, sondern nur eine Teilfunktion davon. Führen beinhaltet viel mehr Informieren, Instruieren, Ziele vereinbaren, Planen, Koordinieren und Motivieren. Die Erfahrung zeigt doch auch, dass man von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, gerade dann viel zurückbekommt, wenn man ihnen das Leben nicht unnötig schwer macht.
These 8: Moderne Gesellschaftsformen weisen zahlreiche Risikofaktoren auf, die sich für jeden Einzelnen nachteilig auswirken können
Die Bemühungen des Menschen, eine stärkere Humanisierung des Lebens durch Technik zu erreichen, richten sich ganz im Gegenteil wider seine biologische Natur. Die hochtechnisierte Welt, in der wir leben, die wir aber auch so gewollt haben, ist durch ein Wechselspiel der Kräfte entstanden. Auf der einen Seite befindet sich der Mensch mit seinem Drang, Neues zu entdecken und zu entwickeln. Auf der anderen Seite steht die Umwelt mit ihren Herausforderungen, die sie an den Menschen stellt. Dieser Spannungsbogen bewirkt Stress. Biologisch betrachtet ist Stress zunächst einmal eine Vorbedingung für das Leben überhaupt. Das Extreme jedoch, ein Zuviel oder Zuwenig, ist schädlich und kann sogar tödlich sein. Während unsere steinzeitlichen Vorfahren die Möglichkeit hatten, die Alarmreaktionen grundsätzlich durch Angriff, Flucht oder Energieeinsatz körperlich umzusetzen, verhindern zahlreiche zivilisatorische Auflagen in der Jetztzeit das instinktive Ausagieren. Die Folge: Aufgrund von Stresssituationen bereitgestellte Energien stauen sich im Körper an, ohne dass ein Abbau derselben erfolgt. Eine Vielzahl biochemischer Prozesse wird unnütz gestartet. Die Zivilisation verliert immer mehr die Fähigkeit, mit der Reizüberflutung und dem Übermaß an Stress umzugehen.
Welche Fähigkeiten werden in der Zukunft in einer global ausgerichteten Lebenswelt wichtig sein? Die Vertreter des Homo sapiens sapiens müssen sich auf verschiedene Kulturen, Religionen und Sprachen vorbereiten. Einen hohen Stellenwert wird die soziale Kompetenz einnehmen. Ganz entscheidend wird aber die Lernfähigkeit sein. Denn für das unfertige Wesen Mensch wird in Zukunft lebenslanges Lernen die Norm sein. Wichtig ist zu wissen, dass die Gemeinsamkeiten von Menschen über kulturelle, sprachliche und ethnische Grenzen hinweg sehr viel größer sind als die Unterschiede. Besonders Politiker sollten begreifen, dass ein Zusammenleben in multikulturellen Gesellschaften nur dann gelingen kann, wenn die kulturellen und intellektuellen Ressourcen ihrer Mitglieder in gegenseitigem Verständnis und zum Nutzen aller eingebracht werden.

Die Bonobos aus Zentralafrika stellen die höchstentwickelte kulturelle Stufe der Menschenaffen dar. Sie haben das Matriarchat als eine sehr wirkungsvolle Sozialstrategie entwickelt. Von einer solchen Organisationsstufe ist der heutige Mensch – unsere DNA ist zu 98,8 % identisch mit der von Bonobos und Schimpansen – noch weit entfernt ... (Bildquelle: Kabir Bakie/Wikimedia Commons)
Für die Entwicklung von Zukunftsperspektiven ist die Frage nach der Belastbarkeit der Erde von großer Bedeutung. Die Grenzen des Wachstums menschlicher Populationen zeigen sich dadurch, dass die Lebensbedingungen durch Dichtestress und Aggression in überbevölkerten Ballungsräumen immer inhumaner werden. Das Leben in Großfamilien und Sippen vermag noch eine Zeit lang dazu beitragen, Aggressionen zu dämpfen. Doch gibt es deutliche Anzeichen für die Zunahme von Brutalität und Kriminalität unter den extremen sozioökonomischen Belastungen, zerfallenden Sozialstrukturen und chaotischen Modernisierungstendenzen inmitten von Elend und Dreck. Mit steigender Individuendichte, und dies gilt auch für entwickelte Länder, steigen nicht nur Kindersterblichkeit und Infektionskrankheiten an, sondern auch seelische Störungen, wie Selbstmordrate, Jugendkriminalität und Geisteskrankheiten.
Die größten Gefahren gehen also von uns Menschen selbst aus, z. B. in Form terroristischer Anschläge und irregulärer Kriegsführung, in Form unkontrollierbarer Konflikte durch globale Völkerwanderungen und durch die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Dies spiegelt sich im sogenannten ökonomischen Nord-Süd-Gefälle wider. Übrigens: Selbst der Krieg, als destruktive, mit Waffen geführte und strategisch geplante Gruppenaggression, ist ein Ergebnis der kulturellen Entwicklung. Er kann daher auch kulturell überwunden werden. Krieg ist nicht in unseren Genen verankert, er hat jedoch insofern mit den Genen zu tun, als er die Eignung (Fitness) der Sieger fördert. Der Mensch ist seiner Motivationsstruktur nach zweifellos zum Frieden befähigt. Will man diesen, kommt man nicht umhin anzuerkennen, dass Krieg gewisse Ansprüche wie jene der Ressourcensicherung sowie Erhaltung der Gruppenidentität erfüllt. Diese Bedürfnisse müssen dann auf andere, unblutige Weise befriedigt werden.
Kriege werden weniger durch Aggressivität denn durch ein Übermaß an Hingabebereitschaft ermöglicht
Kriege werden weniger durch Aggressivität denn durch ein Übermaß an Hingabebereitschaft des Menschen ermöglicht. Dies lässt in beeindruckender Weise sein altes Primatenerbe erkennen. Die Bereitschaft von Menschen zur Loyalität wurde immer schon zu politischen Zwecken missbraucht. Diese angesprochene Neigung zur Ergebenheit ist eine weitere Erklärung für die Mobilisierbarkeit zum gemeinsamen Kampf. Wenn wir verstehen wollen, warum Menschen weltweit in der Lage sind, ihre Mitmenschen auf grausame Art zu töten, dann helfen uns die Erkenntnisse der Historiker, Soziologen und Politologen nicht weiter. Erklärungsansätze kann die Psychologie liefern. Die anthropologische Verhaltensforschung und die Soziobiologie hingegen liefern uns tiefere Einsichten. Sie leiten das Handeln des Menschen nicht nur aus der jeweiligen Kultur her, sondern auch aus biologisch vorgegebenen Tendenzen.
These 9: Eine selbstlose Gesellschaft nach sozialistischem bzw. kommunistischem Muster lässt sich nicht verwirklichen. Dies gilt auch für den Superkapitalismus
Eine Begründung dafür, dass Sozialismus nicht funktionieren kann, liefert der Primatologe Frans de Waal aus evolutionärer Sicht, nämlich „weil seine ökonomische Belohnungsstruktur der menschlichen Natur zuwiderläuft. Trotz massiver Indoktrination sind Menschen nicht bereit, ihre eigenen Ansprüche und die ihrer direkten Familie für das Gemeinwohl aufzugeben. Aus gutem Grund: Moral hat nämlich gar nichts mit Selbstlosigkeit zu tun. Im Gegenteil: Eigennutz ist geradezu der Ausgangspunkt des kategorischen Imperativs.“ Auf die Frage, ob Kapitalismus das geeignetere Modell für menschliches Zusammenleben darstellt, meint de Waal: „Ein System, das nur auf Wettbewerb beruht, bringt ebenfalls große Probleme mit sich. Das sieht man hier in den USA, wo den Kräften des Marktes allzu freier Lauf gelassen wird. Es ist ein Balanceakt: Das Konkurrenzdenken liegt uns genauso im Blut wie das Einfühlungsvermögen (Empathie). Ideal erscheint mir ein demokratisches System mit sozialer Marktwirtschaft, weil es beiden Tendenzen Rechnung trägt.“
These 10: Der Mensch muss gefördert und gefordert werden
Der Mensch ist von seiner Stammesgeschichte her auf Anstrengung programmiert und nicht etwa darauf, ständig glücklich zu sein. Sein Instinktprogramm, das aus einem langen evolutionären Prozess hervorgegangen ist, „kann nicht in ein paar Jahren Zivilisation verschwinden oder weg erzogen werden“, so der Verhaltensforscher Felix von Cube. Zudem sind die Antriebe (Motivationen) und Instinkte spontan. Sie können dabei so stark sein, dass Menschen in bestimmten Situationen Anstrengungen und jedes Risiko auf sich nehmen, um an ihr Ziel zu kommen. In den so genannten Wohlstandsgesellschaften verstoßen wir oft gegen die Gesetzmäßigkeiten der Evolution durch die recht häufige „Programmierung aufs Nichtstun“. Es ist hervorzuheben, dass der Mensch aber von Natur aus aktiv ist! Dazu nochmals Felix von Cube: „Er ist darauf programmiert, seine Trieb- und Aktionspotentiale einzusetzen – nur so erreicht er natürlicherweise den Lohn: die intensive und vielfältige Lust der Triebbefriedigung. Mit seinem Großhirn hat der Mensch in diese ‚Lust-Unlust-Ökonomie’ (Konrad Lorenz) eingegriffen. Er will die Lust ohne Anstrengung. Nun zeigt die Verhaltensbiologie, dass ihm Verwöhnung schadet: Die unverbrauchten Energien führen zu Aggression, zu Zivilisationskrankheiten, zu Langeweile und Unzufriedenheit.“ Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass der Mensch sein „evolutionäres Anstrengungsprogramm“ erfüllen muss – auch (oder gerade deswegen) in den heutigen Wohlstandsgesellschaften. Dies lässt sich verwirklichen durch Förderung der Leistungsfähigkeit und durch Anforderungen, die an das jeweilige Individuum herangetragen werden und ihm Leistung abverlangen. Denn Leistung ist auch eine Voraussetzung für Kooperation und soziale Bindung.
These 11: Der unkontrollierte Trend der Urbanisierung in den Mega-Städten muss zwingend durch intelligente sozialpolitische Strategien kontrolliert werden
Mit der Entstehung von Städten setzte ein bedeutender sozialer Wandel ein, der sich besonders in der Schaffung von Rechtssystemen äußerte und die unmittelbare „soziale Kontrolle“, die in Kleingruppen wirksam ist, durch die „legale Kontrolle“ ersetzte. Wie die heute noch lebenden nomadisierenden Völker und Wildbeutergesellschaften zeigen, haben diese Prozesse zwar bis heute nicht die gesamte Menschheit erfasst, die soziale Evolution des Menschen jedoch in den letzten Jahrtausenden immer stärker beeinflusst. Dabei ist die Geschwindigkeit der Urbanisierung besonders auffällig. Die Situation heutzutage ist hinlänglich bekannt: Die Zahl der Mega-Städte mit über 20 Millionen Einwohnern wird immer größer. Doch dies ist in der Moderne eine Entwicklung in die falsche Richtung. Es ist allgemein bekannt, dass die Kleingruppe mit 30, 40 oder vielleicht 150 Individuen in der sozialen Evolution der Homininen die längste Zeit, nämlich über Jahrmillionen, die maßgebliche soziale Struktur war. Die Zahl der Menschen, die heutzutage in solchen Gruppen leben, stellt jedoch nur noch einen verschwindend geringen Prozentsatz der gesamten Erdbevölkerung dar. In diesen beiden Gesellschaftstypen, nämlich Kleingruppen und Massengesellschaften, wird das Verhalten ihrer Individuen jeweils auf grundverschiedene Weise kontrolliert. Die soziale Kontrolle in Kleingruppen läuft über persönliche Bekanntschaften und direkte Bereinigung von Konflikten. In den Großgesellschaften hingegen wurde die legale, unpersönliche, bürokratische Kontrolle erfunden. Deshalb funktionieren die sozialen Balance- und Kontrollmechanismen in der Anonymität städtischer Massengesellschaften kaum noch. Heute „lohnt“ es sich immer häufiger, egoistisch auf Kosten der Allgemeinheit zu handeln, weil das Risiko, erwischt und bestraft zu werden, viel geringer ist als früher. Es ist daher Aufgabe von Politikern, in Zusammenarbeit mit Städteplanern intelligente sozialpolitische Langzeitstrategien zu entwickeln, um den angesprochenen Sachverhalten entgegenwirken zu können.
Eine globale Ethik ist durch natürliche Selektion nicht konstruierbar
These 12: Metaphysisches Denken, Religionen, Ideale oder politische Ideologien können nicht dazu beitragen, um lokale und globale sozialpolitische Probleme zu lösen
Heutzutage machen es gesellschaftspolitische Gegebenheiten und Entwicklungen sowie immer mehr Ereignisse, die sich weltweit auswirken können (Kriege, Migrationen, Naturkatastrophen, Terrorismus, Verknappung von Ressourcen etc.), zwingend erforderlich, mit hoher Flexibilität und Fachkompetenz darauf zu reagieren. Um solchen Anforderungen besser gewachsen zu sein, wird es künftig wichtig sein, ausschließlich bürokratisch agierende Institutionen stärker durch Organisationen zu ersetzen, die effektive Strategien aufgrund schneller Entscheidungsmöglichkeiten entwickeln und umsetzen können. Außerdem sollte es in der Verantwortung politischer Führungskräfte liegen, die Entwicklung von sozialpolitischen Langzeitstrategien mit zu unterstützen. Ein Aspekt, dem wir im Hinblick auf zukünftige Lösungsstrategien besondere Aufmerksamkeit schenken müssen, ist die Ökologisierung urbaner Ballungsräume. An einer solchen Maßnahme führt kein Weg vorbei. Nur wenn es gelingt, urbane Lebensstile auf einem Verbraucherniveau zu entwickeln, das von allen Städterinnen und Städtern der Welt nachhaltig geteilt werden kann, hat der Planet Erde noch eine Chance. Die Ökostadt kann sich als ein Zukunftsmodell für nachhaltiges Überleben erweisen. Um dieses Modell jedoch praktisch umsetzen zu können, sind tiefgreifende Änderungen unseres Lebensstils erforderlich.
Unter einer Ökostadt hat man sich ein relativ großes Gemeinwesen vorzustellen, in dem verantwortungsbewusst alles Wesentliche getan wird, um das Überleben von Mensch und Biosphäre langfristig zu sichern. Die Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, sollen die Lebensqualität der Stadtbewohner verbessern und in Verbindung damit die Biosphäre entlasten (Bernd Lötsch 1993). Ressourcen sollen geschont werden und der unverantwortlich hohe Energie-, Rohstoff- und Umweltverbrauch der Industrieländer auf ein Maß reduziert werden, das vor den Entwicklungsländern verantwortet werden kann. Die Maßnahmen sollen sowohl der natürlichen Umwelt der Menschen wie auch ihrer „inneren Natur“ gerecht werden. Das bedeutet, dass die angeborenen Verhaltensprogramme der Menschen und ihre seelischen Grundbedürfnisse an Lebensbereich und Sozietät bei allen Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen sind.
Die Evolution hat uns Menschen nicht befähigt, das System „Planet Erde“ durch Selbstkontrolle, durch Selbsteinschränkung oder sogar durch eine umfassende Verantwortung der Biosphäre gegenüber zu steuern. Eine globale Moral bzw. eine globale Ethik ist durch natürliche Selektion nicht konstruierbar. Worin liegt ein möglicher Lösungsansatz? Erforderlich ist eine auf praktische Vernunft und globale Konsensfähigkeit gründende „ökologische Ethik“. Keineswegs hilfreich ist ein Weltmodell, das auf Metaphysik, Religionen, Idealen oder politischen Ideologien beruht. Uns Menschen bleibt nur der gesellschaftlich-politische Weg, eine solche Verantwortung auf der Grundlage ökologischer Ethik zu entwickeln und weltweit durchzusetzen. Weiterhin ist es erforderlich, die Ungleichheit bei der Verteilung von Lebenschancen und Ressourcen zu beseitigen. Dies kann mit dazu beitragen, den Weltfrieden zu erreichen. Gelingt dies nicht langfristig, stehen wir vor einem Abgrund. Dann allerdings stellt sich die Frage, ob der Homo sapiens sapiens auf der Erde noch eine Zukunft haben wird.
LITERATUR
- Horst Afheldt: Wirtschaft, die arm macht. Vom Sozialstaat zur gespaltenen Gesellschaft. Verlag Antje Kunstmann, München 2005
- Dorothea Assig (Hrsg.): Frauen in Führungspositionen. Die besten Erfolgskonzepte aus der Praxis. dtv, München 2001
- Norbert Bischof: Das Rätsel Ödipus. Die biologischen Wurzeln des Urkonfliktes von Intimität und Autonomie. Piper Verlag, München 1989
- Felix von Cube: Fordern statt verwöhnen. Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in der Erziehung. Piper Verlag, München 2010
- Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriss der Humanethologie. Blank Media, Vierkirchen 2004
- Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit. DVA, München 2013
- Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. C. H. Beck, München 2018
- Stephen Hawking: Kurze Antworten auf große Fragen. Kletta-Cotta, Stuttgart 2018
- Theodor T. Klotz: Der frühe Tod des starken Geschlechts. Cuvillier Verlag, Göttingen 1998
- Hans-Peter Martin/Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1998
- Rolf W. Meyer: Der Mann – ein Auslaufmodell? Oder warum Frauen die besseren Strategen sind. Pro Business, Berlin 2006
- Rolf W. Meyer: Vom Faustkeil zum Internet – Die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Humboldt Verlag, Baden-Baden 2007
- Rolf W. Meyer: Hat der Mensch noch eine Zukunft auf der Erde? Eine evolutionsbiologische Betrachtung. epubli, Berlin 2014
- Rolf W. Meyer: Spurensuche zur Entwicklungsgeschichte des Menschen. Oder der lange Weg zur Menschwerdung. epubli, Berlin 2018
- Gerd-Heinrich Neumann: Einführung in die Humanethologie. Quelle & Meyer, Heidelberg 1979
- Robert B. Reich: Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt. Campus Verlag, Frankfurt/New York 2008
- Jeremy Rifkin: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft. Neue Konzepte für das 21. Jahrhundert. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt 2005
- Volker Sommer/Karl Ammann: Die großen Menschenaffen. Die neue Sicht der Verhaltensforschung. BLV Verlagsgresellschaft, München 1998
- Frans de Waal: Wilde Diplomaten. Versöhnung und Entspannungspolitik bei Affen und Menschen. Carl Hanser Verlag, München 1991
- Frans de Waal: Der Affe in uns. Warum wir sind, wie wir sind. Carl Hanser Verlag, München 2006
- Franz M. Wuketits: Soziobiologie – Die Macht der Gene und die Evolution sozialen Verhaltens. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin/Oxford 1997
ZEITSCHRIFTEN
- Heiko Ernst: Wie wir wurden, was wir sind. In: Psychologie heute, Dezember 1996, S. 20-29
- Bernd Lötsch: Ist die Zukunft schon zu Ende? In: Funkkolleg Der Mensch – Anthropologie heute. Studienbrief 10, Studieneinheit 28, 1993, S. 38 f.
- Joachim Müller-Jung: Homo sapiens, der rationale Killer. In: Frankfurter Allgemeine Wissen, 16. Februar 2003
- Volker Sommer: Die Affen. Unsere wilde Verwandtschaft. In: Geo, Gruner + Jahr AG & Co., Hamburg 1989
- Allan C. Wilson/Rebecca L. Cann: Afrikanischer Ursprung des modernen Menschen. In: Spektrum der WIssenschaft, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/Berlin/Oxford 1997
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems