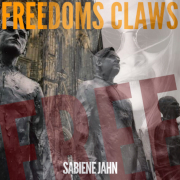zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Wundervolle "Grünkraft": Warum es gerade jetzt lohnt, sie wiederzuentdecken
- Dienstag, 27. April 2010 17:28
Von ROSMARIE BOG
Alles, was grün ist und aus dem Boden wächst, ist für uns Leute von heute Hasenfutter, chemisch gesprochen "Zellstoff", "umwelt-bewusst" betrachtet Biomasse. "Nachwachsende Rohstoffe" nennt man geringschätzig den Mais, die Kartoffeln, mit denen nicht mehr der Hunger gestillt, sondern – beispielsweise – Treibstoff hergestellt wird. Ob es in 20, 30 Jahren wohl noch echtes Brot aus Getreide gibt, wenn immer mehr Grundnahrungsmittel zweckentfremdet werden? Vielleicht ist der Albtraum, der mich zuweilen heimsucht, gar nicht so abwegig: dass wir in nicht allzu entfernter Zukunft bei Hunger eine Tablette einwerfen oder uns nach Astroautenmanier fünf Zentimeter Wurstgeschmack aus der Tube drücken ...
Es gibt eine alte Sage. Sie handelt von der Stadt Vineta hoch droben am Meer. Eine schöne Stadt, eine reiche Stadt, so reich, dass die Bewohner das Korn verheizten. Eines Nachts kam eine gewaltige Springflut und verschlang die Stadt und alles, was darin lebte. Am Morgen war Vineta verschwunden; und nur manchmal, wenn es sehr still ist, hört man die Glocken in der Tiefe läuten.

Für unsere Vorfahren war die Existenz von Elementargeistern, die die Geschicke der Natur lenken, noch eine Selbstverständlichkeit
Ich denke oft mit leisem Unbehagen an diese Geschichte, denn unser Umgang mit den Früchten der Erde ist nicht viel besser als das, was sich die Bewohner von Vineta leisteten. Oder was soll man davon halten, dass es Obstanbauer gibt, die ihre Früchte unmittelbar nach dem Pflücken erntefrisch auf den Müllplatz fahren, um durch die künstliche Verknappung einen besseren Preis zu erzielen?
Die jährlich sich erneuernde Grünkraft der Natur – ein Ausdruck, der von der heute wieder hoch im Kurs stehenden mittelalterlichen Äbtissin Hildegard von Bingen stammt – ist keine Selbstverständlichkeit, über die das Nachdenken nicht lohnt. Sie ist ein Wunderwerk ineinandergreifender Gesetzmäßigkeiten; sie ermöglicht uns Menschen überhaupt erst das Dasein auf diesem Planeten. "Tu mir keine Wunder zulieb, gib deinen Gesetzen recht", schreibt der Dichter Rainer Maria Rilke in einem seiner Gedichte. Wir brauchen in der Tat keine neuen Wunder; das ganz normale Wachstum eines Jahres vom ersten Keimling bis zur aufspringenden Fruchtkapsel ist wunderbar genug. Leider ist unser Kontakt zu Mutter Natur nicht mehr der beste. Wir haben das Gespür für ihre Wunder verloren. Und so ist ein neuer Morgen, der langsam überm Horizont heraufdämmert, schon lange kein Grund zum Staunen mehr.
Den Menschen früherer Zeiten fehlte der naturwissenschaftliche "Background", den wir wie ein paar Kilo Übergewicht mit uns herumschleppen
Heute ist der 26. April, der vorausberechnete Sonnenaufgang ist um fünfuhrvier, so steht es in jedem Kalender. Die Menschen früherer Zeiten betrachteten die Welt mit anderen Augen. Ihnen fehlte der naturwissenschaftliche "Background", den wir wie ein paar Kilo Übergewicht mit uns herumschleppen. Sie lebten nicht als Beobachter neben der Natur, sie waren ein Teil von ihr. Sie wussten noch nicht, dass sie sich die Erde untertan machen sollten, sie waren froh, wenn diese sie trug, ihnen Nahrung, Luft und Wasser gab. Viele Einsichten, die diese Naturmenschen – wie wir sie heute etwas abfällig bezeichnen – noch hatten, sind uns über dem Experimentieren, Analysieren, Sezieren und Quantifizieren verloren gegangen. In gewisser Weise könnte man sagen, Adam hatte zur Zeit unserer Urahnen Evas Apfel vom Baum der Erkenntnis erst zur Hälfte verspeist. Noch gab es Geheimnisse, noch wusste man Bäume, Blumen, Gräser von Elementargeistern, von Feen und Elfen bewohnt, Wesen, die man nicht vergrämen durfte, denn man brauchte ihre Hilfe. Man bat sie um die Blätter des Salbei, wenn es im Hals kratzte, um die Kraft von Thymian und Huflattichblüten, wenn der Husten nicht weichen wollte, um das von ihnen gehütete rote Blut des Johanniskrauts, wenn einem "die Hexe ins Kreuz fuhr".
Dass alles, was auf der Erde wächst, grünt und blüht, eine Seele hat, war für eine mittelalterliche Kräuterfrau, die ständig in Kontakt mit ihren Pflanzen lebte, so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Heute gehört das alles ins Reich der Fantasie. Es ist für Leute mit gesundem Menschenverstand ungefähr so "wahr" wie die Existenz der Frau Holle. Gerade hier aber verläuft die Grenze zwischen dem intuitiven Wissen der Seele und der Skepsis der Reagenzgläser, zwischen lebendigem Glauben und einem Realismus, der nur noch für wahr hält, was als analytisches Untersuchungsergebnis vor ihm auf dem Tisch liegt. Aber haben wir nicht alle manchmal Träume, die "märchenhaft" sind? Die uns nicht loslassen, obwohl sie unsinnig, unlogisch sind? Die wir tagelang wie eine verschlüsselte Botschaft in uns herumtragen und die der Verstand gern als Folge von Verdauungsstörungen wegerklären möchte, um sich ungestört dem normalen Tagesgeschehen zuwenden zu können?
Nicht alles, was uns die alten Überlieferungen von Baumgöttern, von Springwurzeln, von sprechenden Pflanzen und Tieren erzählen, kann man einfach als Lügenmär, als Hirngespinste abtun. Sie sind Teil einer Wahrheit, die in anderen Dimensionen beheimatet ist, zu denen unsere intellektuell abgemagerte Vorstellungskraft keinen Zugang mehr findet. Frau Holle lebt, aber sie lässt sich nicht fotografieren, wenn sie in ihrem Holunderstrauch sitzt. So auch Rübezahl und die Saligen Fräulein im Gebirge und all die anderen wunderbaren Gestalten, schön und hässlich, liebenswert und erschreckend, kauzig, weise und närrisch – Wesen, die aus einer traurig beschnittenen Verstandeswelt eine bunte Welt der Imagination machen. Imagination darf hier nicht mit "Einbildung" übersetzt werden – diese Vokabel hat einen pathologischen Beigeschmack – sondern besser mit "Verbildlichung" von Kräften, Gesetzmäßigkeiten, Naturphänomenen, die "da" sind, ständig am Werk, sich aber unseren Sinnen entziehen.
Märchengestalten und Elementarwesen sind Teil einer Wahrheit, die in anderen Dimensionen beheimatet ist, zu denen unsere intellektuell abgemagerte Vorstellungskraft keinen Zugang mehr findet
"Echte" Mythen – "falsche" Mythen
Alle Völker haben ihre Geschichten von Blumen und Bäumen, von Vegetationsgeistern, von Göttern, die sich dem Menschen als Pflanzenwesen offenbaren. Manche dieser Mythen sind uralt, vielleicht schon an den Lagerfeuern der Steinzeit geboren. Sie zeigen uns eine Welt, in der das Zusammenleben von Pflanze, Tier und Mensch noch sehr eng gewesen sein muss. Da wird eine Fruchtbarkeitsgöttin zur Maispflanze, um ihr Volk vor dem Hungertod zu retten. Da materialisiert sich die Liebe eines Gottes in einem Veilchen, um die Geliebte mit Wohlgeruch und Freude umgeben zu können. Viel Weisheit steckt in diesen alten Geschichten. Eine lebbare, geerdete Weisheit, die viel vom Charakter der Beteiligten offenbart. Schauen wir uns einige solcher alten Überlieferungen an; sie sind nie "moralisch" und gerade deshalb kann man manches aus ihnen lernen.
Da wächst eine Wegwarte am Straßenrand. Für viele die geheimnisvolle blaue Blume der Romantik, erinnert uns ihre Lebensgeschichte daran, dass es Wünsche und Erwartungen gibt, die uns wie eine Leitmelodie durchs Leben begleiten. Und selbst wenn sie nie ganz in Erfüllung gehen: schon der Gedanke an sie gibt unserem Dasein Wärme, Sinn, Tiefe. Der Weg selbst ist das Ziel. So mag es jener jungen Frau ergangen sein, die vor langer, langer Zeit auf die Rückkehr ihres geliebten Freundes wartete. Jahr um Jahr, bei Regen und Sonnenschein, in der Hitze des Sommers und im Eiseshauch der Winternächte saß sie am Rand der Straße, auf der er fortgewandert war, auf der er – so hoffte sie – eines Tages wiederkehren würde. Leute gingen vorüber, schüttelten den Kopf, nannten es Unvernunft und Zeitverschwendung, hier einfach so herumzusitzen und nichts zu tun als einfach nur zu warten. Sie aber blieb. Schließlich, als ihr Haar schon grau geworden war, verwandelten sie die Götter in eine wunderschöne blaue Blume. Und zum Lohn für ihre Treue bekam sie die Gabe zu heilen. All die Ausdauer und Liebesbereitschaft ihres Lebens floss in ihre Heilkraft. Bis auf den heutigen Tag geht von ihr etwas Beruhigendes, Wohltuendes aus. Sie hilft dem kranken Herzen, harmonisiert das Zusammenwirken der Körpersäfte.
Eine bezaubernde Liebesgeschichte ist uns von der Myrte überliefert. Da lebte irgendwo im alten Griechenland ein vermögender junger Mann. Er konnte sich mit allem umgeben, was das Leben schön und angenehm macht; so auch mit einem Myrtenbäumchen, das auf dem Balkon vor seinem Schlafzimmer stand und ihm zur Blütezeit mit süßem Duft die Träume verschönte. Aber auch sonst war etwas an dieser Myrte, was den jungen Mann magisch anzog. Oft setzte er sich neben sie, träumte vor sich hin, fühlte sich in einem halbwachen Zustand von den Ästen des Bäumchens liebevoll umarmt. Eines Nachts legte sich ein wunderbar weicher, geschmeidiger Frauenkörper zu ihm aufs Bett. Es war die Dryade, die Seele des Myrtenbäumchens. Sie umarmten und küssten sich die ganze Nacht, doch am Morgen war alles nur noch eine süße Erinnerung. So geschah es nun viele Nächte, eine lange Zeit. Aber so zauberhaft diese Begegnungen auch waren, der junge Mann wurde immer trauriger, denn die Geliebte blieb für ihn unwirklich, unfassbar, ein zärtlicher, duftender Traum, der mit dem ersten Morgenlicht zerfloss. Er wurde krank. Niemand konnte ihm helfen. Niemandem konnte er von der Wonne seiner Nächte erzählen, denn niemand hatte ihm geglaubt. Seine Kräfte schwanden, er fühlte sich dem Tode nahe. Da erbarmte sich Aphrodite, die Göttin der Liebe, seiner Herzensnot und verwandelte das Myrtenbäumchen in eine Menschenfrau. Und so nahm denn die bittersüße Liebesgeschichte ein gutes Ende. Ewig blieb die Myrte der Göttin dankbar. Sie wurde zum Kraut der Aphrodite. Und noch heute verwendet man ihr ätherisches Öl gern dazu, in Wohnräumen ein Gefühl von Wohlsein und Reinheit zu verbreiten, die Gedanken und Empfindungen der Bewohner zu erhellen und zu klären. Die Blätter schließlich nehmen jede Art von Entzündung, innerlich und äußerlich, aus dem Körper. Myrtes Heilwirkung passt zu ihrer Geschichte. Es ist eine Geschichte von Zärtlichkeit und Behutsamkeit im Umgang miteinander, von Schmerzen, die über Hindernisse hinweg ihre Heilung finden.
Ein Fall von Dauerirrtum betrifft die angeblich "giftige" Milch des Löwenzahns
Die dritte Pflanze, die ich hier noch vorstellen möchte, ist das Gänsefingerkraut, auch Anserine genannt. Sie ist von ganz anderer Art als Myrte und Wegwarte, bodenständig, im Hier und Jetzt verankert. Sehnsüchte und Wünsche nach Wolkenkuckucksheim sind nicht ihre Sache. Sie ist eine fröhliche Pflanze. Ihre Freuden sind die Freuden des Augenblicks: der Sonnenschein, der sie umgibt, der Wind, der ihr dekoratives Blattwerk umfächelt, der Marienkäfer, der sich auf ihrer Blüte niederlässt und ein gediegenes Schwätzchen mit ihr hält. Wer auf ihr schläft, träumt gute, handfeste Träume. Vegetations- und sonstige Erdgeister geben sich gern bei Mama Anserine ein Stelldichein. Wo sie wächst, tut sie sich mit vielen ihrer Art zusammen, denn sie ist ein durch und durch geselliges Kraut, das fast nie als Einzelexemplar anzutreffen ist. Ihr Lebenslauf hat keine großen Höhen und Tiefen aufzuweisen. Sie ist die Pflanze des stillen, "gemütlichen" Gleichmaßes, das aber bitte nicht mit Langeweile verwechselt werden darf. Anserine heilt, was wund ist, und sie löst, was sich verkrampft hat, sei's im Körper, sei's in der Seele. Ihre Botschaft an die Menschen: Seid freundlich zueinander, lacht zusammen, wenn es etwas zu lachen gibt, und weint zusammen, wenn euch traurig ums Herz ist. Aber was ihr auch tut: tut es miteinander, nicht gegeneinander. Vergesst nie, wie schön es ist, eine große Familie zu haben.

Nun gibt es nicht nur "echte" Mythen, die uns in einprägsamen Bildern etwas von der Kraft erzählen, die in manchem Kraut verborgen ist. Es gibt auch "falsche" Geschichten: Irrtümer, die nicht auszurotten sind, Missverständnisse über Wirkung und Beschaffenheit, die sich in schöner Regelmäßigkeit selbst in Kräuterbüchern wieder finden und die zäher im Gedächtnis verwurzelt sind als das schlimmste Unkraut.
Da ist zum Beispiel die Mär von dem ach so eisenhaltigen Spinat. Entstanden ist sie Mitte des vorigen Jahrhunderts in den USA. Spinat braucht keinen besonders guten Boden, und so wurde auf vielen von langer Monokultur ausgelaugten Äckern dieses genügsame Gemüse angebaut. Viel Spinat braucht viele Abnehmer. Das Problem versuchten findige Köpfe mit der Comicfigur des "Popeye" zu lösen. Popeye ist ein Seemann, der ungeahnte Kräfte entwickelt, wenn er eine Dose Spinat isst. Besonders Kindern wollte man die meist ungeliebte grüne Pampe mit dem lustigen Kerl schmackhaft machen. Um dem Seemann auch noch ein wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen, erstellte man eine Analyse aller im Spinat enthaltenen Inhaltsstoffe. Und hier beginnt nun der Siegeszug unseres Dauerfehlers. Beim Abschreiben der Liste – es war noch die computerlose, die schreckliche Zeit – wurde versehentlich beim Eisen das Komma um eine Stelle verschoben mit dem Erfolg, dass sich der Eisengehalt verzehnfachte. Es waren nun nicht mehr 5 mg pro 100 g Spinatmasse, sondern 50 mg. Der Fehler – war's Absicht, war's Schlamperei – wurde nie offiziell korrigiert und so geistert er wohl heute noch durch manche Tabellen.
Ein anderer Fall von Dauerirrtum betrifft die angeblich "giftige" Milch des Löwenzahns. Obwohl dieser weiße Saft in den Stängeln früher sogar kurmäßig (als Blutreinigungsmittel) verwendet wurde, begegne ich auf meinen Kräuterwanderungen regelmäßig dem hartnäckigen Vorurteil, Löwenzahnmilch sei gefährlich und dürfe um Gotteswillen nicht verwendet werden. Mein Rat: Man schicke die Zweifler einfach einmal nach Kärnten. Dort gibt es den so genannten "Röhrlsalat", der aus Löwenzahnstängeln gemacht wird und ganz gewiss noch niemand aufs Krankenlager gebracht hat.
Die übertriebene Auslegung einer wissenschaftlichen Analyse hat den guten alten Huflattich in neuerer Zeit in Verruf gebracht
Die übertriebene Auslegung einer wissenschaftlichen Analyse hat den guten alten Huflattich in neuerer Zeit in Verruf gebracht. Man stellte fest, dass in der Pflanze eine verschwindend geringe Menge eines krebserregenden Stoffs, des sogenannten Pyrrolizidins, enthalten ist. Prompt wurde aus der Fliege ein Elefant gemacht und eine seit Jahrtausenden bewährte Heilpflanze zum gefährlichen Bösewicht erklärt. Huflattich darf seither nicht mehr als Tee verkauft werden und wurde sogar in manchen Hustensäften durch andere Kräuter ersetzt. Der Test, der den Stein ins Rollen brachte, wurde im übrigen mit Goldhamstern durchgeführt, wobei die armen Tierchen mit einer Huflattichmenge traktiert wurden, die, auf Menschenmaß umgerechnet, ungefähr einem Zentner Pflanzenmasse entsprochen hätte. In solchen Portionen wird allerdings selbst der Kamillentee gefährlich. "Die Menge macht's, ob ein Kraut Gift oder Heilmittel ist", heißt es bei Paracelsus.
Ein ähnliches Schicksal widerfuhr dem seit Menschengedenken geachteten und als Knochenheilmittel von Gottes Gnaden bewährten Beinwell. Auch in ihm wurden geringste Spuren von Pyrrolizidin festgestellt, auch er wurde aus den Regalen verbannt und fristet seither in zwei, drei apothekenpflichtigen Heilsalben ein dürftiges Dasein. Schade, dass die zuständigen staatlichen Instanzen bei neu auf den Markt drängenden Chemobomben nicht ebenso vorsichtig und zurückhaltend reagieren wie im Fall Beinwell und Huflattich.
Auch charismatische Heilerpersönlichkeiten wie die bereits erwähnte Hildegard von Bingen sind nicht frei von Vorurteilen und Irrtümern. Hildegard hält beispielsweise überhaupt nichts vom Birnbaum. "Wurzel, Blätter und sein Saft taugen seiner Grobheit wegen nicht zu Heilmitteln", schreibt sie unwirsch. Der Pflaume ergeht es nicht besser. "Die Frucht dieses Baums zu essen", meint sie, "ist Gesunden wie Kranken schädlich und gefährlich. Sie vermehrt die bitteren Säfte (...) und ist deshalb so schlecht zu essen wie Unkraut."
Auch mit der Zwiebel steht unsere Nonne auf Kriegsfuß. Roh gegessen, sei sie schädlich und giftig; nur in gekochtem Zustand könne sie von Menschen mit einem starken Magen verdaut werden. Der schlimmste Bösewicht von allen aber ist für Hildegard der Porree oder Lauch. Er gehört ihrer Meinung nach völlig aus der Küche verbannt, denn "er macht den Menschen ruheloseste Sinnengier." Nun, Hildegard ist trotz ihrer hohen Heilerfähigkeiten eine gläubige Christin. Verständlich, dass sich das sechste Gebot ihres Herrn und Meisters und die Frau Venus aus einer viel älteren Zeit schlecht unter einem Dach vertragen. Der Essbarkeit des so stark gescholtenen Gemüses tut das keinen Abbruch.
Auch charismatische Heilerpersönlichkeiten wie Hildegard von Bingen sind nicht frei von Vorurteilen und Irrtümern
Auch die Zwiebel ist weitaus heilsamer und gesünder, als Hildegards herbe Kritik vermuten lässt. Gehen wir weit in die Geschichte zurück bis zur Zeit der ägyptischen Pharaonen, dann könnte man beinahe sagen, die Pyramiden seien ohne Zwiebel nicht gebaut worden. Die Heerscharen von Arbeitern, die für die Bauarbeiten nötig waren, ernährten sich überwiegend von Zwiebeln und Lauch. Aber auch in unseren Breiten gibt es unter den Kräuterkundigen viele, welche die Zwiebel für ein äußerst nützliches Gewächs halten. Zwiebelsaft hilft Magen und Galle und ergibt, mit Zucker gekocht, ein hervorragendes Hustenmittel. Ein warmer Zwiebelumschlag hilft bei Hals- und Ohrenschmerzen. Allerdings muss jeder für sich herausfinden, wieviel von der heilsamen Schärfe er verträgt, denn Zwiebeln gehören nicht zu den sanften Gewächsen. Überempfindliche, sensible Menschen sollten sie vielleicht besser meiden.
Das gilt aber auch für viele andere Heilpflanzen, denen man deshalb nicht die Freundschaft kündigen muss. Wir begegnen hier ganz einfach einer auf jeden Umgang mit Kräutern zutreffenden goldenen Regel: Man darf nämlich pflanzliche Wirkstoffe nicht unterschätzen, man soll sie immer mit Vorsicht und Respekt verwenden. Pflanzliche Drogen sind hochwirksam; auch sie haben gelegentlich "Risiken und Nebenwirkungen". Vor allem sollte man nie Kräuter pflücken oder verwenden, die man nicht genau kennt.
Warum Birne und Pflaume bei Hildegard so schlecht wegkommen, kann unter anderem auch daran liegen, dass Früchte im Jahr Tausend noch sehr viel herber und unverdaulicher waren als die heute aus diesen Urformen herausgezüchteten Sorten.
Bei allem Respekt, den man Namen wie Hildegard von Bingen, Paracelsus und manch anderem großen Heiler der Geschichte schuldig ist, sollte man doch nie außer Acht lassen, dass sich Lehrsätze auch einmal als überholt erweisen können. Man denke nur daran, wie gründlich sich unsere Lebensweise, das ganze Drum und Dran unseres Daseins, seit Hildegards Zeiten verändert hat. Manchmal mag es durchaus auch einmal angebracht sein, diese Veränderungen in unseren Umgang mit Kräutern mit einzubeziehen.
Wir sind so wundergläubig wie eh und je, heute nur auf andere Weise
Die verschmähten Heiler vor der Haustür
Die weit verbreitete Abhängigkeit von wissenschaftlichen Tests und professoralen Unbedenklichkeitserklärungen beweist keineswegs, dass die Denkart des modernen Menschen "erwachsener" ist als die unserer naiv erscheinenden Vorfahren. Wir sind so wundergläubig wie eh und je, wir sind es heute nur auf andere Weise. Die neuen Zaubermittel gegen Rheuma und Kopfweh kommen nicht mehr aus dem Hexenkessel, sondern aus der Entwicklungsabteilung von Bayer Leverkusen. Das Credo moderner Wundergläubigkeit könnte vielleicht so aussehen: Ich glaube an die heilige Wissenschaft, an die Unfehlbarkeit moderner Untersuchungsmethoden, ich glaube an die Chemotherapie, an das Sakrament der Impfung und an das neue Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung durch die Gentechnik. Eines aber scheint sicher: Die Zeiten solch "einfacher" Pflanzendrogen wie Schafgarbe oder Tausendgüldenkraut gehen zu Ende. Wenn schon Pflanzenmedizin, dann bitte mit einem Hauch Exotik! Warum Birkenblätter und Lindenblüten verwenden, wenn es Teufelskralle aus der Wüste und Weihrauch aus Felix Arabia gibt? Längst ist die Pharmaindustrie voll in das lukrative Geschäft mit der sogenannten Ethnomedizin eingestiegen. Ferne und Fremdartigkeit verkaufen sich gut. "Safran von den Hängen des Himalaya" klingt nun einmal interessanter als "Schweizer Qualitätsgewürz". Je unaussprechlicher der Name, umso größer der Vertrauensvorschuss für das neue Präparat. Und während professionelle Kräutersammler die abgelegensten Erdenwinkel auf der Suche nach den gefragten Pflanzenexoten ausplündern, verkümmern Erdrauch und Nelkenwurz am Gartenzaun.

Die Natur zeigt uns immer wieder, über welche Kraft sie verfügt – im Großen wie im Kleinen: sei es, wenn sie im Frühling aus ihrem Winterschlaf erwacht, sei es als vielseitiges Heilmittel, sei als zartes Pflänzlein, das den Asphalt durchdringt
Der schon zu Lebzeiten weltberühmte, heute immer noch als einer der genialsten Ärzte des ausgehenden Mittelalters angesehene Theophrast Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus, hatte über den Zusammenhang zwischen Herkunft und Wirksamkeit einer Heilpflanze seine ganz persönliche Meinung. Er schreibt: "Einem jeglichen Land wächst seine Krankheit selbst und auch seine Arznei selbst." Das ist eindeutig ein Plädoyer für Weißdorn, Holunder und manch anderes Kraut, das in der Nähe des Menschen hierzulande gedeiht, die gleiche Luft einatmet, dem gleichen Wetter ausgesetzt ist, das sich mit einem Wort auskennt in der Welt der Leute, denen es helfen soll. Vielleicht ist heute ja die Zeit reif für ein ausgewogenes Sowohl-als-auch. Die Welt ist im Satellitenzeitalter klein geworden. Was vor hundert Jahren noch eine Reisestrapaze von mehreren Wochen gewesen wäre, ist heute ein Flug von einigen Stunden. Ob Alaska oder die Wüste Gobi: Alles ist näher an unsere Haustür herangerückt. Probieren wir also ruhig einmal das neu angebotene Heilmittel, das einer alten Indianermedizin "nachgebaut" wurde, aber vergessen wir darüber nicht die alten Freunde am Waldrand drüben: die Gundelrebe, die Engelwurz, das kleinblütige Weideröschen, das klein von Gestalt, aber groß in seiner Wirksamkeit ist. Vergessen wir nicht die vielen Blätter und Blüten, Wurzeln und Früchte, die nur darauf warten, uns helfen zu dürfen. Denn hellsichtige Leute sagen es immer wieder: Kräuter sind freundliche Wesen, sie heilen gern, wenn man sie gewähren lässt.
Warum diese ganzen Überlegungen?
Wir leben in einer unruhigen, spannungsgeladenen Zeit des Umbruchs. Viele Fragen, die längst gelöst schienen, klopfen erneut an die Tür. Medikamente, die den Tod zu besiegen schienen, verlieren ihre Wirksamkeit. Die Wissenschaft hat einiges vom einstigen Nimbus der Unfehlbarkeit eingebüßt; sie überrascht uns alle Jahre wieder mit neuen, "allerletzten" Einblicken in das Räderwerk der Schöpfung, die fünf Jahre später zum Alteisen gehören. Wenn eines sicher ist, dann ist es die Tatsache, dass gar nichts mehr sicher ist. In solchen Epochen allgemeiner Unsicherheit ist man gut beraten, einmal "Bestandsaufnahme" im Haus der eigenen Seele zu machen und die "Welt der zehntausend Dinge", in der wir uns bewegen, ein wenig zu ordnen. Wie steht es beispielsweise mit unserem Mut, im Zeitalter der Talkshows und Fernsehkommentare noch eigenständige Entscheidungen zu treffen? Zum „besten Waschmittel aller Zeiten“ unser ganz persönliches Ja oder Nein zu sagen? Sich selbst zu mögen, auch wenn man nicht die Idealmaße von Claudia Schiffer hat? Funktioniert sie noch, die Stimme unserer Intuition, das, was in den indischen Veden "der heimliche innere Lenker" genannt wird? Durch das Übermaß täglich auf uns einstürzender Nachrichten, Meinungen, Informationen wird es uns sehr schwer gemacht, zu unserer inneren Mitte zu finden, wo wir keine Maske mehr tragen müssen, wo wir etwas miserabel finden dürfen, auch wenn es der allerletzte Schrei ist.
Je unaussprechlicher der Name, umso größer der Vertrauensvorschuss für das neue Präparat
Die Gefahr der Fremdbestimmung ist groß. "Herr Doktor, wie geht es mir heute?" Ein Ausspruch, der von einem der ersten Menschen, denen ein Herz transplantiert wurde, überliefert ist und der seither für mich zum geflügelten Wort geworden ist, wenn es um ein Beispiel für die innere Unsicherheit des heutigen Menschen sich selbst gegenüber geht.
Gerade im Gesundheitsbereich herrscht ein Tohuwabohu sondergleichen. Wer kann sich noch gesund fühlen angesichts der Tatsache, dass jährlich über hundert neue "Krankheiten" entdeckt werden? Bin ich noch ein vollwertiger Mensch, weil ich zuweilen Verdauungsstörungen habe? Entspreche ich noch den Anforderungen der Umwelt, wenn ich mich nicht gegen Schweinegrippe impfen lasse? Wenn ich die kleinen Alltagswehwehchen mit Ringelblume und Johanniskraut kuriere und nicht jeden Schnupfen mit der Penicillinkanone erschieße?
Eigentlich schmeckt mir "morgens um halbzehn" das selbstgeschmierte Butterbrot wesentlich besser als "Knoppers, das Frühstückchen". Und eine Tasse Tee von meiner selbstgesammelten Minze ist bestimmt genussvoller als ein Kunstfruchtjoghurt von "Müller oder was". Brauchen wir wirklich dieses ganze Lügengewebe aus tausend "Needs" und "Wants", die uns eine heile Welt vorgaukeln, in der es fast schon kriminell ist, eine Falte im Gesicht zu haben, wo es doch die (vielzu-)vielen Cremetiegelchen gibt, auf denen "Anti-Aging" steht? Vielleicht sollte ich statt "Shopping" zu gehen doch wieder einmal im Wald drüben Weißdorn und Hagebutten sammeln und den großen Adlerfarnwedeln auf der Lichtung Grüß Gott sagen. Einfach wieder einmal eine Stunde bei Mutter Natur zuhause sein. Mich an die alte Eiche lehnen und die Kraft spüren, die durch die wulstige Borkenhaut der Baumriesin strömt. Wahrscheinlich hilft das meinem Immunsystem mehr als eine Schachtel Vitaminpillen.
Einfach einmal die Tagesschau vergessen. Und die "Leute von heute". Und den Wetterbericht. Und all den anderen Wust von Wissenswertem und Nichtwissenswertem, der einem täglich übergestülpt wird. Einfach im Gras sitzen und hören, wie der Wind weht und die Grille zirpt. Und daheim sein, in mir und in diesem kleinen Stückchen Welt, das groß genug ist für einen Augenblick des Glücks.
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems