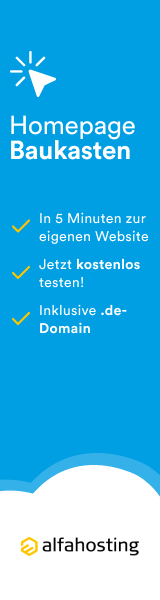zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Aktenzeichen Utoya: Was macht der Fall Breivik mit uns?
- Mittwoch, 16. Mai 2012 17:28
Von UWE HABRICHT
Der Amoklauf von Utoya, bei dem Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 auf der norwegischen Fjordinsel 69 Menschen tötete, ist nicht einfach vorbei, wenn er vorbei ist. Solch ein schlimmer Vorfall wirkt nach, macht betroffen. Das aktuell laufende Gerichtsverfahren erregt die Gemüter auf ein Neues, so dass es sich auf jeden Fall lohnt, eine tiefergehende Analyse zu wagen. Denn etwas, das uns derart ängstigt, fordert uns gleichermaßen auf, es genauer zu betrachten, Zusammenhänge ganzheitlich zu verstehen und als Gesellschaft daran zu wachsen.
Nicht selten wird gefragt, ob in solch einem Fall, in dem doch die Faktenlage wie auch die Schuldfrage klar seien, überhaupt noch ein Prozess zu führen ist, der doch nur Kosten verursache. Bei aller Brutalität des Verbrechens, jeder Mensch einen fairen Prozess verdient hat. Die Verhandlung dient zudem der Identifizierung des Täters mit seiner Tat und dem Erkennen, welche Konsequenzen diese für ihn selbst hat. Vielmehr noch hilft der Prozess der Aufarbeitung des Traumas für die Öffentlichkeit. Und Traumen müssen verarbeitet werden, damit sie nicht im kollektiven Unbewussten „weiter schmoren“ und noch mehr Unheil anrichten.
Die Medien spielen dabei eine eminente Rolle. Der Grad der Sensibilität, mit der sie den Prozess an nach Außen transportieren, bestimmt darüber, welche Wirkung dieses Ereignis nachträglich auf uns ausübt. Es erscheint befremdlich, wenn sich Breivik seiner Tat öffentlich rühmen darf. Geht dieses Zugeständnis an den Täter zu weit? Wo verorten wir die Grenze zwischen Zerstörungswille und dem Recht, sich unserer Aufmerksamkeit zu bedienen? Wo setzen wir überhaupt die Grenze zwischen Gewaltszenarien und dessen Infiltration in unsere Köpfe?
Wir werden ungewollt Teil des Gesamtszenarios
Natürlich stehen wir solchen Grausamkeiten hilflos und ohnmächtig gegenüber. Doch es scheint, als hätten wir verlernt, uns diese Ohnmacht einzugestehen. Mit der täglichen Dosis Brutalität und Desaster als Nervenkitzel, von den Fernsehmachern unter dem Deckmantel der „Unterhaltung“ serviert, haben wir offenbar unser kreatürliches Verhältnis zum Thema Gewalt eingebüßt. Die allerseits legitime Gewaltverherrlichung suggeriert uns die Kontrollierbarkeit der Welt: Der Gute gewinnt immer, clevere Wissenschaftler retten die Welt …
Anstatt uns jedoch der Ohnmacht zu stellen, suchen wir Ursachen, wo es vielleicht keine gibt. Doch das Zulassen dieses Gedankens wäre ein weiterer Schrecken für unsere Ratio. Also wird weitergeforscht. Die unreflektierte Unsicherheit führt zu einer unheilvollen Symbiose mit den Medien, welche von unserer Aufmerksamkeit leben und sich ihrer bedienen. Wir werden ungewollt Teil des Gesamtszenarios.
Darf es denn sein, dass eine solche Tat weder zu erklären, noch zu rechtfertigen ist? Geht es zu weit, zu behaupten, dass wir erst dann zur Besinnung kämen, wenn wir uns der Übermächtigkeit und Unkontrollierbarkeit solcher Taten stellen müssten? Wäre dies die Haltung, die uns zur Demut verhülfe, die sich auch darin zeigen müsste und sollte, dass wir unser Verhältnis zur Gewalt überhaupt überprüfen sollten?
Das Verbrechen von Utoya rückt auch die alte Frage nach dem Antagonismus bzw. der Ambivalenz von Freiheit und Abhängigkeit menschlichen Handelns in den Blickpunkt. Es stellt die Frage, ob Breivik überhaupt eine Wahlmöglichkeit hatte, diese Tat auszuführen. Und damit auch, ob er psychisch krank ist oder nicht. Wenn krankhaft hier bedeutet, die Macht über sich selber verloren zu haben, dann ist Breivik offensichtlich krank. Doch gibt es den Gesunden und den Kranken überhaupt? Ist nicht ein jeder Tag für Tag gefordert, die eigene Balance in einer illusionären Welt voller Lügen und Manipulationen zu finden? Wer wahrhaft frei ist, werfe den ersten Stein …
Irgendwo lassen wir alle uns verorten auf einer Skala zwischen Opfer und Täter, Gewalttätiger und Retter, Wunsch und Wirklichkeit, bewegen uns in diesen Dimensionen, verharren nie dauerhaft an nur einem Pol. Im Regelfall verfügen wir über die Eigenmacht, unser Verhalten selbst zu steuern, uns zu supervidieren und auszubalancieren, sobald wir merken, dass wir uns und anderen schaden. Gefährlich wird es, wenn jemand diese Eigenmacht nicht (mehr) hat. Gefährlich in diesem Sinne sind die Schwachen, nicht die Starken!
Was nützt uns das Statement von jemandem, der diese Eigenmacht verloren hat? Was nützen uns betroffene Minen von Nachrichtensprechern, die im ehrfurchtsvollen Ton berichten, Breivik hätte geäußert, sein Verbrechen nicht zu bereuen und dass er es wieder tun würde? Liegt hier vielleicht auch etwas Faszinierendes im Schrecken, dem wir uns nur schwer entziehen können und das heimlich wirkt? Wie oft bedienen wir unser Bedürfnis, am Schrecklichen teilzuhaben, wenn auch auf einer virtuellen, erlaubten Ebene? Können wir uns diese Faszination eingestehen? Welcher Kinohit kommt noch ohne Schocker aus?
Breivik rechtfertigt das Schreckliche für sich ideologisch und wird damit zu dem, was er angeblich bekämpfen will
Offenbar sind wir alle derart manipuliert und konditioniert, haben die eigenen Gefühle und Emotionen, die wir als „verboten“ wahrnehmen, längst abgespalten. Die Filmindustrie einerseits und die dahingehend verlogene Moral der „Gewaltlosigkeit“ anderseits haben einen unauflösbaren Konflikt in unserem Verstand erschaffen. Wir führen ein Dasein im Konsum von Emotionen – vom „Bergdoktor“ bis hin zu Katastrophen in „Blockbustern“ (wörtlich: „Fliegerbomben“!).
Menschen wie Breivik bieten uns eine willkommene Gelegenheit, unsere „normale“ Welt zu definieren, ohne deren eigene Schrecklichkeit und Widersprüchlichkeit in den Blick nehmen zu müssen. Breivik ist ja der „Schreckliche“, von dem wir uns distanzieren können. Doch auch hier schlägt die Polarität der Welt zu. Aus der moralischen Entrüstung wird paradoxerweise keine echte Distanzierung, sondern eine symbiotische Verstrickung: Täter und Öffentlichkeit bestätigen sich dann gegenseitig in ihren Wirklichkeitskonstruktionen. Und während sich der Täter verteidigt und die Medien sich entrüsten, bleiben die Opfer ungesehen. Deren Leid bleibt draußen. Was für eine Farce. Wo Mitgefühl für die Hinterbliebenen das Menschliche ausmachen würde, wird der Täter auf die Bühne gebeten!
Kann es das Schreckliche, das Gewalttätige außerhalb von mir selbst überhaupt geben? Diese Frage kann nur jeder für sich beantworten. Breivik selbst ist offenbar weit davon entfernt, das Schreckliche in sich als das anzuerkennen, was es ist. Er rechtfertigt es für sich ideologisch und wird damit zu dem, was er angeblich bekämpfen will. Vielleicht sind wir am meisten jenen Kräften ausgeliefert, die wir nicht anerkennen wollen. Breivik bezieht – wieder paradoxerweise – die Legitimität seines Handelns aus unserem Fingerzeig.
Wir hätten unsere Eigenmacht zurück und wüssten, wie mit Verbrechen wie dem von Utoya umzugehen ist, wenn wir darauf verzichten könnten, Breivik als Vorzeigebösen zu stilisieren. Doch das ist in unserer Konsumwelt, in der alles medial ge- und verbraucht wird, wohl leider undenkbar. Und das ist auch der Zwang, dem wir offenbar unterliegen. Es ist daher ein Wagnis, jenseits der diskurs-geifernden medialen Selbstbefriedigung, zu behaupten: Es gibt für Utoya weder Erklärungen noch Entschuldigungen, sondern lediglich Verantwortung – sowohl die der Gerichtsbarkeit, als auch die der Medien.
Eine Verantwortung, die sich darin zeigt, dass alle Möglichkeiten geschaffen werden, dass Breivik die Tat „zu sich zurücknimmt“, anstatt sie zu rechtfertigen und die Gewalt damit in unseren Köpfen fortzusetzen. Das wäre die Würde, die ihm als Mensch zusteht. Ob ihm geholfen werden kann, zu seiner Tat emotional vorzudringen und sich der Tragweite dieses Verbrechens zu stellen, mag dahingestellt sein. Vielleicht besteht diese Chance in der Haft, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon vorher?
Es gibt für Utoya weder Erklärungen noch Entschuldigungen, sondern lediglich Verantwortung
Die Verantwortung einer Welt, die sich auf die Fahnen schreibt, gewaltfrei leben zu wollen, sollte aber ihrerseits verantworten, dass sie das Thema Gewalt noch lange nicht verstanden hat. Und sie wird es auch weiterhin nicht verstehen, wenn sie sich solchen Verbrechen voyeuristisch zuwendet.
Das Zerstörerische ist da, es zeigt sich in seinen vielfältigsten Ausprägungen. Es bekämpfen zu wollen ist ebenso illusionär wie es durch virtuelle Fantastereien kontrollieren und verdrängen zu wollen.
Verbrechen wie das von Breivik können vermutlich nie ganz verhindert werden. Doch wir können lernen, sie zu beherrschen, auf sie zu antworten, mit ihnen so umzugehen, dass sich die Gewaltspirale nicht verstärkt, sondern das Lebensbejahende, wenn man so will „das Gute“, unser gesellschaftliches Leben bestimmt, weil wir ihm den Vorrang geben. Zuerst gilt es, achtsam mit dem umzugehen, was unsere Köpfe den Tag durch okkupiert. Denn hier beginnt alle Realität – jeden Tag neu.
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems