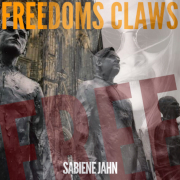zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Rückblenden, Island (III)
- Donnerstag, 04. September 2008 22:15
III: UR
Von FRIEDERIKE BECK
Ur ist im Deutschen ein Präfix, eine Vorsilbe, die die Aufgabe hat, ein Adjektiv oder Substantiv auf bestimmte Weise zu charakterisieren, indem sie sich vorschaltet.
Auf Islands Flughafen Keflavik wird man von einer Statue Leifur Eriksons, dem isländischen Entdecker und Besiedler Nordamerikas, von ihm „Weinland“ genannt, begrüßt.
Beim Isländischen scheiterte ich grandios an seiner urtümlichen Kompliziertheit
Vom Deutschen her gesehen hat das Isländische einige urige Formen bewahrt, die aber keineswegs urtümlich-urgoßväterlich klingen, sondern eher allzeit jung, attraktiv und vokalreich-klangvoll.
Ich habe die Angewohnheit, mir vor Reisen in andere Länder einen Sprachführer zu besorgen und mir Grundkenntnisse der jeweiligen Sprache in ein paar Tagen „reinzubimsen“. Eine zumindest rudimentäre Möglichkeit der Kommunikation mit den Bewohnern des zu besuchenden Landes ist mir äußerst wichtig. Beim Isländischen scheiterte ich jedoch grandios an seiner, nun ja, urtümlichen Kompliziertheit und der Unwegsamkeit seiner uralten, gebirgige Sprachlandschaft, die nicht mal eben beklettert, sondern im vollen Bewusstsein der Gefahren und am besten schwindelfrei bezwungen werden will. Mein Erstbesteigungsversuch endete folgerichtig mit einem urkomisch-kläglichen Absturz schon im Vorfeld, obwohl ich mich ursprünglich als durchaus sprachbegabt gesehen hatte. Zum ersten Mal dämmerte mir ansatzweise, wie man sich wohl beim Erlernen des Deutschen fühlen könnte …
Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich, wenn ich nicht konkret gestresst zum Englischen greifen musste, bei meinen Sprachwahrnehmungsversuchen auf eine gewisse Urverwandtschaft gefühlsmäßig zu besinnen und zu versuchen, gemeinsame Urlaute irgendwie herauszuhören, in etwa so, wie man versucht, sich einer verwandten, aber nicht sehr vertrauten Urgroßmutter zu entsinnen.
Überraschenderweise gelang mir das bei vielen Begriffen problemlos und mit einer Art Wiedererkennungseffekt, bei anderen Wörtern jedoch konnte ich die Urform der Nuss nicht mal ansatzweise knacken. Sprachwissenschaftler können für dieses Urphänomen sicherlich eine schlüssige Erklärung liefern.
Mein erstes Aha-Erlebnis oder Sesam-Öffne-Dich war denn auch „Inngangur“, das klangvoll-poetische, frisch und urig klingende Wort, das − ganz klar − auf Deutsch einfach nur „Eingang“ heißt. So merkte ich auch, wenn es um „Innihald“ ging, ob ich jedoch wirklich verstand, was drinnen war, ist eine andere Frage ...
Jedem Touristen wird in Island unter die Nase gerieben, dass die Isländer dank ihrer eifersüchtig-wachsamen und stolzen Liebe zu ihrer Sprache ihre jahrhundertealten Götterlieder und Sagas fast problemlos noch heute lesen können. Dies würde natürlich niemand wagen in Zweifel zu ziehen ... Sicher ist, dass die alten germanischen Überlieferungen noch immer eine sehr lebendige Rolle spielen. So bemerkte ich bei einer Abschlussfeier, dass der Abiturient gleich zweimal eine reich bebilderte Ausgabe der Edda geschenkt bekam. Auch Geschenkausgaben der Völuspa sind nichts Ungewöhnliches. Noch gewisser ist auch, dass wir ohne die Isländer kaum etwas von den germanischen Vorstellungen über Weltanfang und Weltende wüssten, die Götterdämmerung nicht so ohne weiteres in Bayreuth hätte stattfinden, Tolkien nie in seinen Themen und Variationen schwelgen und Peter Jackson nie seine Triologie hätte drehen können. Ob die Welt dadurch ärmer wäre? Ganz gewiss.
Island konnte aufgrund seiner isolierten Lage am Rande Europas in Ruhe seine Sprachtraditionen pflegen
Island konnte aufgrund seiner isolierten Lage am Rande Europas (und Amerikas) in Ruhe seine Sprachtraditionen pflegen und wie es scheint, neuen sprachlichen Herausforderungen gelassener begegnen als Deutschland: Die Insel schaffte es über die Jahrhunderte, Sprachimporte zu verankern, zu verarbeiten und zu einer Bereicherung werden zu lassen, nachdem sie sich das Überflüssige wieder aus den Kleidern geschüttelt hatte.
Sprachimporte wurden schon immer vorwiegend von den jeweils tonangebenden Kreisen getätigt und auch als Herrschaftsinstrument in Gebrauch genommen: Jede Epoche hatte ihre Lingua franca, sprich vorherrschende Verkehrssprache:
Der preußische König Friedrich der Große, der fand, das Nibelungenlied sei keinen Schuss Pulver wert, sprach Deutsch nur gebrochen und die Befehle, die er seinen gehorsamen Untertanen erteilte, waren in der Regel mit französischen Fremdworten durchsetzt und ließen klar erkennen, dass er lieber zu Hofe mit Voltaire disputierte und das Deutsche verachtete. Er kauderwelschte, dass es eine Art hatte. Jeder, der damals etwas auf sich hielt, parlierte französisch. Koketterie und Schick sind im Deutschen mittlerweile auch als unerlässlich anerkannt worden, Parapluie, Etui und Portemonnaie werden dagegen immer weniger estimiert.
In Deutschland ist heute erneut mindestens ein solches Maß an sprachlicher Entfremdung erreicht wie im 18. Jahrhundert am Hofe des ersten preußischen Dieners seines eigenen Staates: Jeder, der etwas auf sich hält, spricht heute nur noch gebrochen Deutsch. Deutsche Politiker, Unternehmensmanager, Werbungschaffende, Medienvertreter, kurz, alle sich zu (ton-)angebenden in-groups Zählenden talken auf English, und die Gesetze, Strategies, Spots und News, die sie ihren gehorsamen Untertanen verordnen, sind mit, na Sie wissen schon, durchsetzt: Das lässt klar erkennen, dass sie lieber unter sich im Think-Tank sitzen und das Deutsche verachten.
Das Deutsche hört gerade auf, eine Volkssprache zu sein
In Island ist es mit der Globalisierung eine etwas einfachere Angelegenheit: Die jeweilige Lingua franca, früher das Dänische, heute Englisch, wird in der Schule ausgiebig gelehrt, und es steht dafür genügend Zeit zur Verfügung (Island 14, Deutschland 12 Jahre). Im Prinzip besteht also in Island mindestens Zweisprachigkeit. Im Übrigen stellt man sich den Anforderungen der Moderne, indem man einen neuen Begriff als solchen erkennt, derzeit meist aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum kommend, diesen zur Diskussion stellt und eine Zeit lang Vorschläge der isländischen Öffentlichkeit entgegennimmt, wie dieser Begriff wohl am geeignetsten zu übersetzen sei. Diese werden abschließend einer Art „Allthing“1 von Sprachexperten vorgelegt, das daraus dann den besten auswählt.
Telefon wurde „sími“ genannt, was „Band“ bedeutet. Laut meinem ethymologischen Wörterbuch lässt sich dieses Wort auf eine indogermanische Wurzel für „binden, Strick, Riemen“ zurückführen. Sicherlich eine gute Umschreibung der Auswirkungen des Telefons, nämlich zwischen Menschen ein Band herzustellen, sie in einem Kommunikationsnetz zusammenzubinden. Dies scheint mir gleichzeitig auch eine gute Definition für den Sinn und Zweck von Sprache überhaupt zu sein: Menschen zusammenzuführen, Verbindungen zu ermöglichen oder herzustellen.
Diese Beispiele, die ich hoffentlich richtig interpretiert habe, sollen zeigen, dass das isländische Sprachverständnis einem organischen Ansatz entspricht. Ursprünglich fühlte sich auch das Deutsche diesem Ansatz verpflichtet, der gleichzeitig auch urdemokratisch ist (Island war ja bekanntlich die erste Bauernrepublik mit dem ersten Parlament Europas, dem bereits erwähnten Allthing).
Obwohl es im Deutschen (wie auch im Isländischen) eine tatsächlich unbegrenzte und überdies äußerst elegante Methode zur Wortneuschöpfung gibt, die andere Sprachen in diesem Maße nicht besitzen, lässt man diese Fähigkeit verkümmern
Denn auch technische Fachwörter werden nach diesem Verfahren übersetzt, wobei die Allerneusten den (meist) englischen Begriff gleichzeitig mitführen.
Die Grenzen solcher Sprachkreativität sind natürlicherweise dort, wo Neuschöpfungen überflüssig werden: entweder, weil die Gruppe der die Fachsprache Benutzenden zu klein und zu unbedeutend ist und/oder weil sich eine Übersetzung des Begriffes in die Muttersprache nicht lohnt, da das zu Bezeichnende dermaßen kurzlebig ist. In letztere Gruppe würde ich Gerätschaften wie den iPod (gesprochen I-Pott oder eher AI-Pott?) einordnen: Da sich niemand die Mühe gemacht hat, mir über das Wort selbst einen Bedeutungshinweis zu geben, bin ich folgerichtig auch nicht scharf darauf herauszufinden, was oder gar wer sich hinter diesen Buchstaben verbergen könnte, denn ich möchte nicht ausschließen, dass es sich sogar um einen, vermutlich recht i-pott-hässlichen, Außerirdischen handeln könnte. Da er mir aber noch nicht über den Weg gelaufen ist, nehm’ ich’s erst mal mit Gelassenheit.
Die oben beschriebene wichtigste Funktion von Sprache erfüllt Deutsch hingegen schon seit längerem nicht mehr. Der Begriff „deutsch“ (theudisk) war ursprünglich als Gegensatz zu (walhisk), den Welschen zugehörig, gemeint und bezeichnete die Volkssprache (theoda = Stamm) im Gegensatz zum Lateinischen. Um 700 n. Chr. bezeichneten sich die Westfranken im mehrsprachigen Merowingerreich (germanisch, altfranzösisch, lateinisch) als „theodisk“ und meinten damit ihre germanische Volkssprache.
Man kann hieraus entnehmen, dass das Deutsche sich schon in seinen ersten Anfängen „volkstümlich“ gab und sich namentlich vom Altfranzösischen und den gelehrten, Latein sprechenden Klerikern der romanischen Sprachgruppe abgrenzte, lange bevor es überhaupt den Begriff der Nation gab. Deutsch heißt ganz einfach die „Volkssprache“.
Das Deutsche hört gerade auf, eine Volkssprache zu sein, also eine Sprache, die problemlos von der ganz großen Mehrheit der Deutschsprechenden verstanden wird. Im deutschen Sprachraum scheint sich keiner mehr so recht verantwortlich dafür zu fühlen, dass das Deutsche eine weitgehend aus sich selbst heraus verständliche Sprache bleibt, die über Klassen-, Schicht-, Alters- und Berufsgrenzen und Einzelinteressen hinweg Verständigung ermöglicht. Obwohl es im Deutschen (wie auch im Isländischen) eine tatsächlich unbegrenzte und überdies äußerst elegante Methode zur Wortneuschöpfung gibt, die andere Sprachen in diesem Maße nicht besitzen, lässt man diese Fähigkeit verkümmern: Die Sprache verjüngt sich kaum noch, stattdessen wird importiert. (Eine Parallele zur auf dem Kopf stehenden Bevölkerungspyramide?) In der Tat ist das Deutsche äußerst anpassungsfähig und flexibel in der Möglichkeit der Wortneuschöpfung nach einer Art Bausteinprinzip, indem es einfach Bedeutungswurzeln beliebig neu zusammenfügt. Gleichwohl sieht es sich einer Art ständigen Diskriminierung als „zu kompliziert“, „zu lang“, „nicht anpassungsfähig genug“ ausgesetzt.
Der ungehemmte und schon ins grotesk-surrealistisch gehende Import von Anglizismen spaltet die Gesellschaft gleich mehrfach
Ah ja. Irgendjemand hat beschlossen, dass die Sprache von ca. 100 Millionen Menschen nicht mehr allgemein verständlich sein muss, sondern sich in verschiedene Sprachen von Interessengruppen aufspalten darf.
Soziale Rücksichtnahme wird hier mit sprachlicher Rücksichtnahme verwechselt. Ein sozial nicht so leistungsstarkes oder schwaches Niveau von Teilen der Gesellschaft muss ein schwaches sprachliches Niveau der Gesamtgesellschaft nach sich ziehen …? Sozialhilfe bizarr.
Es wird auf die damals noch so bezeichneten Gastarbeiter (heute Personen mit Migrationshintergrund) hingewiesen. Diesen Personen wird tatsächlich das sprachliche Leben erleichtert, wenn sich das allgemein verständliche Deutsche, das sich an einem gemeinsamen Sprachleitbild orientiert, in Fachsprachen von Interessengruppen etc. aufspaltet …?
Mhmhmm. Das Ergebnis solcher sicherlich nicht demokratisch gefassten Beschlüsse sehen wir heute immer klarer:
In einer Gesellschaft, die sozial auseinanderdriftet, in der immer weitere Bevölkerungsteile von einem sozialen Abstieg erfasst werden, sie gewisse Gesellschaftsspiele nicht mehr mitspielen können (Urlaub, Auto, Shopping etc.), andere dagegen noch nie dagewesene Rekordgewinne und Rekordgehälter einstreichen, versagt auch noch die Sprache darin, eine gemeinsame Klammer der Gemeinsamkeit zu liefern, sondern reißt im Gegenteil die Gräben noch weiter auf.
Der ungehemmte und schon ins grotesk-surrealistisch gehende Import von Anglizismen spaltet die Gesellschaft gleich mehrfach:
In Alt und Jung: Viele Menschen haben vor einigen Jahrzehnten noch keinen, wenig oder einen anderen Fremdsprachenunterricht (wie etwa mit Schwerpunkt Französisch) genossen. Infolgedessen tappen sie bei den allermeisten Anglizismen völlig im Dunkeln. Berüchtigtstes Beispiel: Als die Deutsche Post 1995 privatisiert wurde und Ron Sommer beschloss, die Rechnungen und Dienstleistungsangebote der neu gegründeten Telekom weitgehend auf Englisch zu verfassen, brauchten selbst Sprachbewanderte oft Monate, um sich durch den Dschungel von Timobeil über tschätten und Zittitolk bis hin zu ollinklusif zu arbeiten. Die Telefonrechnung musste man natürlich trotzdem ganz locker bezahlen.
Weiterhin wird die Sprachgemeinschaft in Ost und West gespalten:
In den Ländern der ehemaligen DDR wurde bekanntlich vor allem Russisch als Fremdsprache unterrichtet. Grundkenntnisse im Englischen sind natürlich meist auch vorhanden, aber keinesfalls eine offensichtlich erwartete Bilingualität.
Die Deutschen haben ganz offensichtlich ein Problem mit sich, ihrer Geschichte und ihrer Sprache
Neuen Gegebenheiten, technischen Errungenschaften der Moderne, neuen Lebenssituationen, wird in Island mit einer Sprachneuschöpfung begegnet, die aber Wurzelkomponenten benutzt, die das neue Wort aus sich heraus verständlich machen. Es ist daher nicht erforderlich, um dieses Wort zu verstehen, eine besondere Ausbildung zu haben, einer bestimmten sozialen Schicht, Berufsgruppe, regionalen Bevölkerungsgruppe mit Standortvorteil etc. anzugehören.
Noch heute kämpft man im Deutschen mit Heimaroiden und Püschologen, also den durchgesetzten Gruppeninteressen einer sprachlichen Sondergruppe, der Ärzte und Therapeuten, die Sprache als Herrschaftsinstrument gebrauchten, um durch Anwendung einer weitgehend unverständlichen Fachsprache eine sprachlichen Trennwand und ein Hierarchiegefälle (und oft auch eine Fassade) zu errichten, hinter der und mit dem sie Autorität einfordern und Hinterfragen vermeiden konnten und können.
Es ist daher höchste Zeit, dass sich das Deutsche fragt, wer mit dem dauernden Input (Aufpfropfen) von Anglizismen heutzutage eigentlich welche Herrschaftsinteressen verfolgt, wer Autorität einfordert und wer sich hinter dieser Sprachfassade verstecken möchte.
Für den Versuch der Ursachenforschung, zumindest was die deutsche Willigkeit anbelangt, diesen dauernden Input (oder eigentlich Inpush) zuzulassen, müssen wir etwas zurückschreiten:
Es leuchtet einerseits ein, dass sich nicht nur Deutschland infolge des Zweiten Weltkrieges nach einem verlorenen totalen Krieg innerlich und äußerlich in der totalen Kritik wiederfand, sondern sich dies naturgemäß auch auf die Sprache der Deutschen auswirkte. Nicht nur wurde das deutsche Sprachgebiet durch Abtrennung großer Staatsgebiete und Eliminierung der dortigen Sprachteilnehmer verkleinert, die Deutschen und das Deutsche standen unter Generalverdacht, denn: Hitler hatte schließlich Deutsch gesprochen, oder meist leider gebrüllt ... Die Verbrechen, die im Namen Deutschlands begangen wurden, wurden natürlich auch auf Deutsch begangen. Keine guten Voraussetzungen also für poor old German.
Selbstkritik ist sicherlich gut und notwendig. Ein „weiter so“ war für Deutschland 1945 auf keinem Gebiet mehr möglich. Selbstkritik muss aber mittels einer gründlichen und vor allem berufenen Analyse stattfinden und, ganz wichtig, irgendwann mal zu einem Abschluss kommen. Ansonsten wird die notwendige Kritik, der akute Reinigungs- und Läuterungsprozess, zu einem chronischen Leiden und Siechtum, wovon dann nicht mehr der Patient, sondern nur noch andere profitieren können.
Die Deutschen haben ganz offensichtlich ein Problem mit sich, ihrer Geschichte und ihrer Sprache. An sich ist die Fähigkeit zu einer bis an die äußersten Grenzen gehenden Selbstkritik, Selbstbezweifelung etc. lobenswert. Richtig gefährlich für die Völkergemeinschaft werden denn wohl auch Nationen, denen diese Fähigkeit über lange Zeiträume hinweg völlig abgeht. Das in die Kritik geratene Selbst, die Identitätskrise, kann natürlich auch durch Selbstentleibung behoben werden, auch im sprachlichen Bereich. Eine praktische Lösung? Absolut. Fragt sich nur für wen.
Deutsch findet sich selbst doof und hässlich, irgendwie zu alt und fett, nicht zum Singen geeignet, nicht trendy und sexy genug
Nun sind sich Therapeuten andererseits einig, dass Anorektiker tragischerweise an einer Wahrnehmungsstörung leiden. Ihr gestörtes Verhältnis zur Realität lässt sie ihren besorgniserregenden Zustand nicht mehr bemerken: Sie fühlen sich zunehmend fitter, attraktiver und schöner, während sie vom ärztlichen Standpunkt aus gesehen immer mehr zum Fall für die Intensivstation werden. So wage man denn auch nicht, Argumente des Schönen und Guten, ewig Hinanziehenden, des Stils, der Ästhetik, des Sprachgefühls anzuführen: Ein Blick in den Spiegel belehrt den Sprachanorektiker eines Besseren – full stop!
Grübelnd: Eigentlich sollte sich eine Sprache verhalten wie eine schöne Königstochter. Sie sollte die Reihe der vorsprechenden, nicht abreißen wollenden Heiratsbewerber auf die Probe stellen, mit strengem Blick und kühlem Kopf mustern und sich fragen: Welchen Nutzen habe ich davon? Passt der Kandidat wirklich zu mir? Wird die Verbindung halten, ist er klug genug, schön genug, werde ich auch im Alter noch mit ihm froh sein und werden wir hübsche Kinder haben? Stattdessen führen die Eltern oder diejenigen, die sich als solche ausgeben, dem Mädel einen ständigen Strom zweifelhafter Freier zu und halten kein bisschen auf die Ehre der ihnen Anvertrauten.
Der Bewerber kann so i-pod-hässlich und sein Name zudem unaussprechlich sein wie er will – King Drosslebeard war daneben ein ausgesprochener Adonis – und ruhig Recycling oder Outsourcen heißen, er darf der Schönen trotzdem beiwohnen.
Alles kein Problem: Die arme Königstochter muss rund um die Uhr „weltoffen“ sein, muss ständig herhalten, obwohl ihr eigentlich immer derselbe Bewerber, nur in unterschiedlichen Verkleidungen zugeführt wird, und die Ärmste so nicht einmal die Möglichkeit hat, einen wirklich zu ihr passenden Seelengefährten überhaupt kennenzulernen.
Doch Scherz beiseite. In Wirklichkeit ist unsere Königstochter natürlich schon eine würdige Frau mit einigen charaktervollen Ausdrucksfalten und reichlich Lebenserfahrung. Gleichwohl musste sie sich vor kurzem einer ziemlich schmerzhaften Schönheitsoperation unterziehen. Statt ihre Falten zu achten und zu ehren, sollten ihre Gesichtszüge sexy geglättet und gestrafft werden. Sie musste sich einige schmerzhafte Botoxinjektionen und Silikonimplantate gefallen lassen. Ihrer Tendenz, Worte neu zu erfinden und zusammenzufügen, wurde mit einer Papierschere ein Riegel vorgeschoben. Man hatte sie bestürmt, nur so würde sie noch gefallen, nur so können man sie in einer sich immer schneller globalisierenden Welt noch verstehen und attraktiv finden. Stattdessen ist sie jetzt nicht nur alleinstehend, sondern obendrein noch allein stehend geworden.
Eigentlich sollte sich eine Sprache verhalten wie eine schöne Königstochter
- Allthing: traditioneller Name für das isländische Parlament
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems