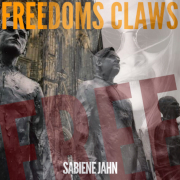zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Wohlstandskinder als Armutskonsumenten
- Donnerstag, 02. April 2015 09:22
In der „Generation Praktikum“ sind Freiwilligenreisen heiß begehrt: Länder – Menschen – Abenteuer, kombiniert mit sozialem Engagement. Jugendliche auf Sinn- und Erfahrungssuche sind bereit, für den organisierten Aufenthalt in der Fremde viel Geld hinzublättern, zumal sie glauben, dass es ihnen die Tür in die Berufswelt öffnet. Findige Reisebüros wittern in der Unsicherheit und Unerfahrenheit der jungen Leute einen großen Gewinn und locken sie zu überteuerten Umwelt- oder Entwicklungsprojekten in die Armenhäuser der Welt. Dort wird den reichen Kindern des Westens der Zynismus ihrer Reise bewusst: Statt wirklich etwas tun zu können, beschauen, ja konsumieren sie die Armut.
In den letzten Jahren sind die Ansprüche an Berufsanfänger stark gestiegen, sodass der direkte Berufseinstieg nach dem Studium häufig eine Illusion bleibt. Statt eines festen, gut entlohnten Jobs erwartet viele Absolventen eine Warteschleife aus schlecht oder gar nicht bezahlten Hospitanzen, in denen sie nicht selten dasselbe zu leisten haben wie andere Arbeitnehmer, Überstunden inklusive. Summa summarum: Praktikanten werden heute gerne als billige Arbeitskräfte missbraucht. Da jedoch Auslandserfahrung im Anforderungsprofil vieler Firmen erwünscht ist, suchen die jungen Leute sie durch Freiwilligenreisen in ferne Länder zu erwerben.
Hier eröffnet sich für Organisationen und Reisebüros das große Geschäft: Praktikawelten oder STA-Travel etwa locken Interessenten mit tränenrührenden Bildern und Worten in ihre Projekte und gaukeln ihnen vor, sie könnten ohne große Vorkenntnisse auf wohltätigen Kurztrips in Ghanas Waisenhäusern oder Brasiliens Favelas die Welt retten. Die Kosten dafür liegen hoch: Die Teilnahme an einem vierwöchigen „Projekt“ etwa kostet über 1200 Euro, weitere 2000 fallen für Flug, Medizin, Verpflegung und Visum an – immense Beträge für einkommenslose Praktikanten. Am Reiseziel angekommen, erleben sie dann „Voluntourismus“ pur: Sinnstiftende Aufgaben Mangelware; Land, Menschen und Kultur werden durch die Touristenbrille vermittelt. Bringt das den Ärmsten der Armen etwas? Sicher nicht. Bedenkt man den häufigen Wechsel der Volontäre, schadet es eher. Zudem fließt mit mickrigen 17 Euro kaum mehr als ein Prozent der überteuerten Reise an die Bedürftigen.
Reisebüros gaukeln Praktikanten vor, sie könnten auf wohltätigen Kurztrips in Ghanas Waisenhäusern oder Brasiliens Favelas die Welt retten
Die Wohlstandskinder des Westens erwarten indes innigen Dank für ihr „Engagement“, für den einstigen Volontär Martin Oßberger purer Zynismus. In seinem Buch „Der Tod tanzt, Afrika lebt“ schreibt er: „Wir begutachten doch ihre Armut“, die Afrikaner hätten „alles Recht der Welt, uns rauszuschmeißen“. Andere Kritiker wie etwa die zweite Vorsitzende der Entsendeorganisation „Schule fürs Leben“ Ulla Schuch teilen diese Sicht, sie vergleicht die Gutmenschenreisen mit einem traurigen Film, in dem Betroffenheit konsumiert wird und den man mit dem Heimflug wieder abschaltet.

Fern der Realität: Versprechungen und bunte Bilder sollen zu Auslandspraktika verlocken (Quelle: Screenshot der Website eines renommierten Reiseanbieters)
Auch Non-Profit- und staatlich geförderte Organisationen bieten dergleichen Reisen an. Konträr zur Tourismusbranche zielen ihre Entwicklungs- und Umweltprojekte jedoch mehr auf Nachhaltigkeit als auf Gewinn ab. Veranstalter wie Hope Village oder weltwärts verknüpfen ihre Reiseangebote mit Seminaren zur Selbstreflektion oder mit Sprachkursen, zumeist sind längere Aufenthalte vorgesehen, begleitet durch Mentoren vor Ort. So weit, so gut, doch der Schein trügt, so die Kritiker, die durch Sinnstiftung veredelten Abenteuerreisen seien letztlich „Egotrips in die Armut“. Zudem bestehe die Gefahr, dass Volontäre den Indigenen Arbeitsplätze wegnehmen. Und die „populistischen“ weltwärts-Projekte, so Entwicklungsexpertin Claudia von Braunmühl, würden die Bedürfnisse verfehlen, denn unqualifizierte Gutmenschen würden in Entwicklungsländern nicht gebraucht.
Berufseinsteigern und anderen Qualifikanten empfiehlt sich, die Bauernfängerei der Organisatoren zu meiden und besser grundsätzlich darüber zu sinnieren, ob man sich dem zwanghaften Trend zum Aufpolieren der eigenen Vita wirklich unterwerfen möchte. In der Praxis zählen bei der Bewerbung schlussendlich vor allem vorhandene Fähigkeiten und als gesunder innerer Antrieb die Berufung, für die man brennt. Und falls es tatsächlich die Entwicklungshilfe sein soll – warum nicht gleich ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten? Die Frage, ob man sich dafür unbedingt in die Dritte Welt begeben muss oder besser vor der regionalen Haustür kehrt, beantwortet sich dann von selbst.
ANMERKUNGEN
- „Abiturienten als Entwicklungshelfer – sinnlose Kurztrips ins Elend“, Panoramasendung vom 19.12.2013
- „Erst Waisenhaus, dann Safari“; stern.de, veröffentlicht am 22.11.2012
- „Egotrips ins Elend“, SZ-Magazin, Heft 19/2008
- Martin Oßberger: Der Tod tanzt, Afrika lebt. Verlagshaus Schlosser, Friedberg 2013
- Claudia Pinl: Freiwillig zu Diensten? Über die Ausbeutung von Ehrenamt und Gratisarbeit. Nomen Verlag, Frankfurt/Main 2013
IM NETZ
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems