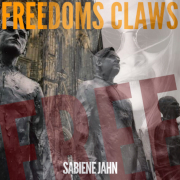zeitgeist auf Telegram
Das aktuelle Heft
Edition H1 (Kunstbuch)
Die 10 neuesten Onlinebeiträge
- Kommt Zeit, kommt Mut
- Faschismus in Europa im Zusammenhang denken: bahnbrechende Dokumentation bei RT
- Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zur Disposition
- Deutsches Reich – von Versailles bis Versailles
- „Heil dir im Siegerkranz“ – zur Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871
- Der beschädigte Nimbus: Fälschung, Betrug und Streit in der Wissenschaft
- Vom Tag der Deutschen Einheit zum Tag des Zorns
- Regime Change in Belarus?
- Berlin im August 2020: Hört auf die Menschen!
- Hochhuth – der zwiegespaltene Rebell
Triumph der Lakaien
- Sonntag, 02. September 2012 13:19
Heiducoff, Scholz, Rose, Pfaff – allesamt aufrichtige Offiziere der Bundeswehr, die mit ihrer unliebsamen Kritik aneckten und schließlich vom „System“ aussortiert wurden. Ihre Warnungen vor einem Wiedererstarken des deutschen Militarismus verhallten ungehört. Der Artikel zeigt, warum wir heute dringender denn je mehr von jener raren Sorte Soldat brauchen, die mutig zu ihrem Gewissen steht.
„Ich gerate zunehmend in Widerspruch zu dem, wie die eigenen westlichen Truppen in Afghanistan agieren. Es ist unerträglich, dass unsere Koalitionstruppen und ISAF inzwischen bewusst Teile der Zivilbevölkerung und damit erhoffte Keime der Zivilgesellschaft bekämpfen“, erklärte Oberstleutnant Jürgen Heiducoff in seinem brisanten Lagebericht vom Frühjahr 2007 an den deutschen Außenminister Walter Steinmeier. „Ich stelle dabei zunehmend fest“, so Heiducoff weiter, „dass die militärische Lage unzulässig geschönt dargestellt wird.“1
Derart schonungslos demaskierte Heiducoff am 13. Mai 2007 in einer vom Gewissen getragenen Lageanalyse den Militäreinsatz der NATO in Afghanistan. In seiner Funktion als militärpolitischer Berater des deutschen Botschafters in Kabul offenbarte der couragierte Offizier die ungeschönte Situation und zeigte die zerstörerische „Eskalation der militärischen Gewalt in Afghanistan“ auf.2
Zwischen Heiducoffs Kritik und seiner Ablösung will der Dienstherr keinen Zusammenhang sehen
In seine Kritik bezog Heiducoff auch deutsche Generäle ausdrücklich mit ein. Die scharfe Analyse schlug als „Brandbrief“ wahrnehmbare Wellen: Man wollte ihn sofort loswerden, ohne – bis heute – mit ihm über das Thema zu sprechen. „Aber ich konnte noch weitere 15 Monate in Kabul bleiben“, schrieb Heiducoff in einem Brief an den Autor, „bis ich per Urteil des Bundesverwaltungsgerichts abgelöst wurde.“ Das erscheint vor allem vor dem Hintergrund der Personalpolitik von Verteidigungs- und Außenministerium kaum nachvollziehbar. Schon im Tschetschenienkrieg 1995/96 hatte Heiducoff als Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) intern und dann öffentlich das Vorgehen der russischen Verbände gegen die tschetschenischen Separatisten und Zivilisten kritisiert. Das mag damals noch durchaus im Sinn der Bundesregierung gewesen sein.
Vor seiner Versetzung auf den wichtigen Dienstposten als militärischer Berater des deutschen Botschafters in Kabul wurde der profilierte Offizier umsichtig vorbereitet. So konnte Heiducoff 2004/05 als Einsatzoffizier im Stab der multinationalen Brigade vor Ort landestypische Erfahrungen machen. Während seines fast dreijährigen Dienstes als Offizier der Bundeswehr in Afghanistan wurde er Zeuge von seiner Auffassung nach unverhältnismäßiger militärischer Gewalt gegenüber Zivilisten, diesmal jedoch durch die westlichen Verbände. Wiederholt kritisierte er dieses Vorgehen in seiner Funktion als militärpolitischer Berater der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Analysen und Bewertungen und empfahl eine strategische Neuausrichtung, die eine Stärkung der Zivilgesellschaft in den Vordergrund stellen solle. Zwischen Heiducoffs Kritik und seiner Ablösung will der Dienstherr keinen Zusammenhang sehen. Heiducoff stellt einen solchen als gegeben dar, und weist darauf hin, dass ihm gegenüber keinerlei Disziplinarverstöße oder Fehler, die zu seiner Ablösung hätten führen müssen, geltend gemacht wurden.

Wohin wird der Weg der ehemaligen Verteidigungsarmee Bundeswehr künftig führen? (Im Bild: deutsche Soldaten im Einsatz in Kunduz, Afghanistan; Quelle: ISAF Headquarters Public Affairs Office, Wikimedia Commons)
In den Folgemonaten eskalierten die Verluste: 75 tote NATO-Soldaten allein im Juli 2009, 1013 getötete Zivilisten im ersten Halbjahr. Auch für die Hilfsorganisationen war der Juli mit 23 Sicherheitsvorfällen und fünf Toten der schlimmste Monat.3 Nie war die Sicherheitslage für Entwicklungshelfer so explosiv – ein Ergebnis der Vermischung von Wiederaufbau und Militär. Und am 4. September 2009 schien für viele in der Welt wieder die Fratze des deutschen Militarismus aufzutauchen: Auf Befehl des deutschen Kommandeurs des Wiederaufbauteams in Kunduz, Oberst Georg Klein, wurden zwei in der afghanischen Provinz Kunduz vom Feind gekaperte und im Flussbett festgefahrene Tanklaster einschließlich der sich in nächster Nähe befindlichen Zivilisten bombardiert.
Dabei sollen nach NATO-Einschätzung bis zu 142 Menschen, darunter auch Kinder, getötet oder verletzt worden sein. Am nächsten Tag verfasste Oberst Klein eine zweiseitige Meldung an Generalinspekteur Schneiderhan: „Am 4. September um 01.51 Uhr entschloss ich mich, zwei am Abend des 3. September entführte Tanklastwagen sowie an den Fahrzeugen befindliche INS [,Aufständische‘, Anm. d. Verf.] durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten.“ Den Bombenabwurf habe er befohlen, „um Gefahren für meine Soldaten frühzeitig abzuwenden und andererseits mit höchster Wahrscheinlichkeit nur Feinde des Wiederaufbaus Afghanistans zu treffen“.4 Der Wiederaufbaukommandeur doch eher ein Kampfkommandeur? Das lässt zumindest seine nur wenige Monate vor dessen verhängnisvollen Befehl gemachte Äußerung über seine Aufgaben in Afghanistan zu: „Wir werden mit der Härte, die geboten ist, zurückschlagen.“5
Drei Jahre nach der Kunduz-Affäre soll Oberst Klein zum Abteilungsleiter im neuen Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr berufen werden
War aber diese Härte geboten? Als ehemals aktiver Offizier (SaZ 12) und danach 13 Jahre lang als Wehrübender, fällt dem Autor unvermittelt das „Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr“6 (UZwGBw) ein.

Auszug aus dem UZwGBw
Dieses Gesetz gilt im Frieden für die Bewachung militärischer Liegenschaften, und 2009 hat die Bundesregierung noch peinlichst vermieden, in Afghanistan von Krieg zu sprechen. Erst Verteidigungsminister zu Guttenberg sollte unter großem Beifall den Begriff „kriegsähnlich“ einführen – was noch nicht eindeutig Krieg bedeutet. Im Kriegsfall gelten nämlich die Regeln des Humanitären Völkerrechts. Und die kennen keinen absoluten, sondern lediglich einen eingeschränkten Schutz der Zivilbevölkerung.
Der Maßstab für die rechtliche Bewertung des Luftschlags ergibt sich nach Ansicht es Autors vorrangig aus den Vorschriften des Völkerstrafgesetzbuches. Der relevante Paragraph 11, Absatz 3, des Völkerstrafgesetzbuchs legt fest, dass ein Kriegsverbrechen begeht, wer „mit militärischen Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher erwartet, dass der Angriff die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte in einem Ausmaß verursachen wird, das außer Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil steht“.7
Am 4. September 2009 scheint nicht nur die Verhältnismäßigkeit, sondern auch der Schutz der Zivilbevölkerung in grobem Maße außer Acht gelassen worden zu sein. Auch ließ dieser gnadenlose Akt die Gewalt weiter eskalieren und erwies sich als absolut kontraproduktiv für den originären Auftrag der Bundeswehr: am Hindukusch Frieden und Sicherheit zu schaffen sowie den Wiederaufbau zu fördern. Dort herrschte Krieg und Chaos, während sich hier in großen Teilen der Öffentlichkeit Entsetzen und Empörung breit machte. „Der Spiegel“ titelte: „Ein deutsches Verbrechen“. Auch das befreundete Ausland war befremdet.
Völlig zu Recht wurde nach dem Bombenmassaker umgehend der Ruf nach juristischen Konsequenzen für die Verantwortlichen laut. Sicherlich ist Oberst Klein noch kein Kriegsverbrecher und auch kein Mörder, da ein sogenanntes Mordmerkmal wie beispielsweise Habgier oder eine besonders grausame Art der Tötung nicht vorliegt. Wer aber durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, muss sich „wegen einer fahrlässigen Tötung nach § 222 StGB8 verantworten und abhängig von den Umständen des Einzelfalls mit einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren oder gar nur mit einer Geldstrafe rechnen.“9
Leider war der Ruf nach juristischen Konsequenzen vergebens, was der ehemalige Luftwaffenoberstleutnant Jürgen Rose bedauerte.10 Die Ermittlungsverfahren sowohl der Generalbundesanwältin als auch des Wehrdisziplinaranwalts gegen Oberst Georg Klein wurden eingestellt. Angeblich war sein Handeln nach den maßgeblichen Kriterien des humanitären Konfliktvölkerrechts rechtmäßig. Dieser Einschätzung konnte der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Wolfgang Nešković, nicht folgen und verfasste daraufhin den lesenswerten Artikel „Neben der Spur“. Ein Gerichtsverfahren, in dem Neškovićs Bewertung hätte geprüft werden können, hat es nicht gegeben. Auch der Inspekteur des Heeres fand nach viermonatiger Prüfung keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen.11
Am 8. September 2009, in der Schlussphase des Wahlkampfs, hatte Kanzlerin Angela Merkel die lückenlose Aufklärung als ein Gebot der Selbstverständlichkeit bezeichnet und der Nation versprochen, dass die Bundeswehr „mit allen zur Verfügung stehenden Kräften genau dazu beitragen“ werde. Nach der Wahl jedoch kam die Wirklichkeit nur sehr gefiltert in die Öffentlichkeit: Der Beschuss von Kunduz wurde vertuscht, relativiert und kleingeredet. Daran hat sich bis heute wenig geändert.
Offiziere, die Karriere machen wollen, wissen, dass sie ihr Gewissen besser ins Wertfach des Spindes einschließen
Schon am Tag des Kunduz-Einsatzes warnte ein deutscher Diplomat in einer internen Stellungnahme, „dass diese Welle in deutscher Öffentlichkeit ,Tsunami-Qualität' im Wahlkampf erreichen könnte". Das sollte verhindert werden, mit allen Mitteln.12 Während Oberstleutnant Jürgen Heiducoff auf einem unattraktiven, karriereverhindernden Dienstposten seiner Pensionierung entgegensehen musste, hatte Oberst Georg Klein bald Grund zur Freude. Er stieg schon ein Jahr später als Chef des Stabes der 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig in die Besoldungsgruppe B3 auf, was einer Gehaltserhöhung von 600 Euro monatlich entspricht. Drei Jahre nach der Kunduz-Affäre soll er nun zum Abteilungsleiter im neuen Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr berufen werden, was dann gegen Ende des nächsten Jahres die Ernennung zum Brigadegeneral zur Folge haben wird (Grundgehalt: 6635 Euro monatlich).13
Was wird angesichts dieser Karriere der unerschrockene und inzwischen pensionierte Oberstleutnant Heiducoff empfinden? Er fragt sich, „wie mögen tausende Bundeswehr-Kameraden denken, deren Karriere wegen eines kleinen Fehlers ein für allemal gestoppt wurde infolge einer schlechten Beurteilung …?“14 Weiter macht er sich Sorgen, wohin sich die Bundeswehr entwickelt: „Dass sie zu einer Interventionsarmee umgebaut wird, ist klar. Doch was wollen diejenigen, die die Entscheidung zur Förderung Kleins getroffen haben, erreichen? Was wollen sie damit sagen? Dass Du bei der Bundeswehr machen kannst, was du willst, und trotzdem geschützt wirst?“
Aber wie werden vor allem die Angehörigen der Opfer auf diese für sie eindeutige Verhöhnung reagieren? Ein totes Kind als Äquivalent eines halben Monatslohnes von Herrn Klein? Welcher Hass kommt jetzt bei den Familien der Opfer im Raum Kunduz auf? „Warum müssen die Bundeswehrsoldaten in Kunduz heute diese zu erwartende höhere Gefährdung erdulden? Sie tragen keine Schuld“, schreibt Jürgen Heiducoff und schließlich: „Ich bin müde geworden, weil wir nicht gehört werden.“
Die erkennbare Fürsorge um Oberst Klein könnte nicht zuletzt darin liegen, dass er den verhängnisvollen Befehl von höherer Stelle erhalten und dann die Verantwortung mannhaft übernommen hat. Da sich der Entscheidungsprozess für diesen Vernichtungsschlag über vier Stunden hinzog, ist davon auszugehen, dass sich in diesen Prozess das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mit Hauptsitz in Geltow bei Potsdam eingeschaltet hat. Dieses Kommando – ein gemischter und streitkräfteübergreifender Stab aus Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis, Sanitätsdienst und Verwaltung – setzt die Vorgaben der politischen Leitung in militärische Aufträge, Befehle und Weisungen um und führt den Einsatz deutscher Streitkräfte unterhalb des Bundesministeriums der Verteidigung ...
Alljährlich wird zum Jahrestag des 20. Juli 1944 der Opfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gedacht und betont, was sie für die Selbstachtung unseres Landes und für eine bessere Zukunft auf sich genommen haben. „Deswegen bezeuge ich heute“, so Bundespräsident Horst Köhler am 60. Jahrestag, „meinen und aller Deutschen Respekt und Dankbarkeit vor dem Mut und dem Gewissen der Verschwörer, vor der Tat des 20. Juli."15 Leider hat der Respekt vor Mut und Gewissen nur an diesem Gedenktag eines jeden Jahres Konjunktur. Offiziere, die Karriere machen wollen, wissen, dass sie ihr Gewissen besser ins Wertfach des Spindes einschließen. Schon der eiserne Reichskanzler Bismarck bemerkte, dass Zivilcourage – also der Mut zum eigenen Entschluss und zur eigenen Verantwortung – in Deutschland eine rare Tugend sei. Und Sebastian Haffner, Publizist und Historiker, attestiert dem deutschen Militär schließlich fehlende Zivilcourage. Der Mut zur eigenen Verantwortung komme dem Deutschen vollkommen abhanden, sobald er eine Uniform anzieht. „Der deutsche Soldat und Offizier, zweifellos hervorragend tapfer auf dem Schlachtfeld, fast stets auch bereit, auf Befehl der Obrigkeit auf seine zivilen Landsleute zu schießen, wird furchtsam wie ein Hase, wenn er sich gegen die Obrigkeit stellen soll.“16
Der Mut zur eigenen Verantwortung komme dem Deutschen vollkommen abhanden, sobald er eine Uniform anzieht
In ihrer rigiden Kritik sind Bismarck wie Haffner deutlich übers Ziel geschossen. Nicht nur am 20. Juli 1944 hat es Soldaten mit Gewissen gegeben. Die preußisch-deutsche Militärgeschichte hat durchaus leuchtende Vorbilder:
Auf dem Grabstein von Johann Friedrich Adolf von der Marwitz (1723–1781) in Friedersdorf ließ sein Neffe neben die üblichen Angaben folgende Worte setzen: „Sah Friedrichs Heldenzeit und kämpfte mit ihm in all seinen Kriegen. Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte.“ Das kam so: Gegen Ende des Siebenjährigen Krieges eroberten die preußischen Truppen das Jagdschloss der Kurfürsten von Sachsen Hubertusburg in der Nähe von Leipzig. Oberst Marwitz bekam das Schloss von König Friedrich II. dem Großen geschenkt, mit dem Auftrag, es gründlich zu plündern.17 Auf diese Aufforderung des Königs antwortete Marwitz, „es würde sich allenfalls für den Offizier eines Freibataillons schicken, nicht aber für einen Kommandeur Seiner Majestät Gensdarmes“ und ersuchte um Abschied aus der Armee.
Da ist weiter General Hans David Ludwig Graf Yorck von Wartenburg (1759–1830). Der Preuße schloss am 30. Dezember 1812 in der litauischen Stadt Tauroggen mit dem russischen General Diebitsch die so genannte Konvention von Tauroggen. Gegen den Willen seines Souverän trat Yorck mit seinem preußischen Kontingent auf die Seite der Russen, rettete dadurch das preußische Heer und gab damit den Anstoß zur Befreiung.
Auch die Bundeswehr hat nicht nur den mutigen Oberstleutnant Jürgen Heiducoff. Den früheren Oberstleutnant der Luftwaffe, Jochen Scholz, kennen viele aus dem Dokumentarfilm „Unter falscher Flagge“. Er hat sowohl im Verteidigungsministerium als auch in diversen NATO-Gremien gedient. Aus Begeisterung über die Rede des PDS-Fraktionsvorsitzenden Gysi am 25. März 1999 (als der amtierende Bundestagspräsident Thierse mit einer lapidaren Bemerkung zum Kriegsbeginn am Abend des Vortages zur Tagesordnung übergehen wollte) hatte Jochen Scholz noch am selben Tag Kontakt zur PDS-Bundestagsfraktion aufgenommen.18 Der Katholik und Sozialdemokrat lehnt die Pläne ab, aus der Bundeswehr eine Eingreiftruppe für Krisengebiete in aller Welt zu machen.
Der bereits erwähnte Luftwaffenoberstleutnant Jürgen Rose wurde öffentlich bekannt durch sein erfolgreiches Ersuchen, aus Gewissensgründen von seinen Aufgaben hinsichtlich des Afghanistankonflikts entbunden zu werden. Bis dahin konnte er eine Bilderbuchkarriere vorweisen: Er war u. a. in Fort Bliss in Texas/USA, dann Ausbildungsleiter für die interaktive Simulation Politik und Internationale Sicherheit (POL&IS). Von 1991 bis 1995 war Rose wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internationale Politik, Sicherheitspolitik, Wehrrecht und Völkerrecht an der Uni der Bundeswehr München, von 1995 bis 1998 am George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen und „External Fellow“ am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Inzwischen ist die Transformation der NATO zu einer Interventionsarmee in vollem Gang
Am 15. März 2007 bat Rose, von allen Aufträgen, die seine Mitarbeit an Unterstützungsleistungen, die den Einsatz von Tornado-Jets zur Kampfunterstützung am Hindukusch sowie generell die von ihm als völkerrechtswidrig erachtete „Operation Enduring Freedom“ beinhalten, entbunden zu werden.19 Seinen Vorgesetzten erklärte er wörtlich, dass „ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, den Einsatz von TORNADO-Waffensystemen in Afghanistan in irgendeiner Form zu unterstützen, da meiner Auffassung nach nicht auszuschließen ist, dass ich hierdurch kraft aktiven eigenen Handelns zu einem Bundeswehreinsatz beitrage, gegen den gravierende verfassungsrechtliche, völkerrechtliche, strafrechtliche sowie völkerstrafrechtliche Bedenken bestehen. Zugleich beantrage ich hiermit, auch von allen weiteren Aufträgen, die im Zusammenhang mit der ,Operation Enduring Freedom‘ im Allgemeinen und mit der Entsendung der Waffensysteme TORNADO nach Afghanistan im Besonderen stehen, entbunden zu werden.“20 Rose wurde daraufhin durch den SPD-Wehrexperten Rainer Arnold aufgefordert, angesichts seiner massiven Vorbehalte den Dienst mit der Waffe zu quittieren und aus der Bundeswehr auszuscheiden.21 2009, zwei Jahre vor seiner vorzeitigen Pensionierung erschien sein vielbeachtetes Buch „Ernstfall Angriffskrieg: Frieden schaffen mit aller Gewalt?“
2003 erregte der Fall des Bundeswehr-Majors Florian Pfaff die Öffentlichkeit. Er sah seine Mitarbeit am Projekt „Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien“ (SASPF) als indirekte Unterstützung des Irak-Kriegs und verweigerte daher seine Mitarbeit aus Gewissensgründen. Seither ist Pfaff aktiv in der Friedenbewegung tätig und ruft alle Kameraden zur Ablehnung direkter und indirekter Unterstützung von Angriffskriegen, sowie die Öffentlichkeit zur Beendigung der Anstiftung von Soldaten zur ungesetzlichen Mitwirkung an Angriffskriegen auf (siehe auch sein Buch „Totschlag im Amt. Wie der Friede verraten wurde“, März 2008). Er vertritt die Ansicht, dass die universelle Gültigkeit der Menschenrechte und der Vorrang des Rechts und der Moral vor der Macht nur gewaltfrei und auf demokratischem Weg erkämpft werden können und dass jeder Einzelne sich konsequent entziehen und seine Mitarbeit verweigern sollte, sobald er merkt, dass er an einem Unrecht mitwirken soll. Seiner Meinung nach ist der erste Schritt zum Frieden die Wahrheit und die beste Methode das Belegen der zum Zweck der Kriegsführung jeweils erfundenen Unwahrheiten. Der Versuch, ihn fristlos zu entlassen blieb erfolglos, ebenso die vom Truppendienstgericht ausgesprochene Degradierung. Am 21. Juni 2005 wurde Florian Pfaff durch das Bundesverwaltungsgericht rehabilitiert.
Die Aussage von Bundesverteidigungsministerium und Bundesregierung, die Bundeswehr kämpfe in Afghanistan im Rahmen eines „nicht-internationalen bewaffneten Konfliktes“ und unterliege somit in der juristischen Bewertung militärischen Handelns dem Humanitären Völkerrecht, erfolgte erst nach dem Bombenangriff von Kunduz und ist damit durchaus fragwürdig. Inzwischen ist die Transformation der NATO zu einer Interventionsarmee in vollem Gang: Alle Kriege nach 1999 stehen im Einklang mit Clintons NATO-Doktrin, welche drei Kriegsgründe gelten lässt:
1. Humanitäre: Unter dem Mantel „humanitärer Interventionen“ gilt es, den gar nicht so humanitären „Zugang zu Rohstoffen“ zu sichern.22
2. Migrationsbewegungen, die den Weltfrieden bedrohen: Migrationen bedrohen den Weltfrieden nicht per se. Es sind vielmehr die Kriege, die zum Verlassen des Kampfgebietes zwingen und dadurch den Weltfrieden in Gefahr bringen: Im Kosovo waren es 1999 eine Million Flüchtlinge, und heute sind es zwei Millionen im pakistanischen Swat-Tal.
3. Ressourcensicherung: Aufschlussreich führt das offizielle Bundeswehr-Magazin Y dazu aus: „Das Ende des Kalten Krieges nährte den Traum vom Frieden weltweit. Stattdessen erleben wir heute asymmetrische Kriege. Dazu zeichnet sich eine neue Auseinandersetzung ab: der Kampf um Rohstoffe, eine neue globale Konfliktlinie. Das wirtschaftliche Wachstum Chinas und Indiens erfordert immer mehr Energieträger und Metalle, welche die Industrieländer allein für sich beanspruchen.“23
Es zeichnet sich eine neue Konfliktlinie ab: Das Schmelzen der Nordpolkappe hat einen Wettlauf um die dortigen Bodenschätze entfacht
In der Tat zeichnet sich eine neue Konfliktlinie ab: Das Schmelzen der Nordpolkappe hat einen Wettlauf um die dortigen Bodenschätze entfacht. Für den beginnenden Kampf um die Ölreserven des Hohen Nordens ließ Ex-US-Präsident George W. Bush noch am 9. Januar 2009 in einer Sicherheitsdirektive festschreiben: Die „USA haben große und fundamentale nationale Sicherheitsinteressen in der Arktis." Der Aufbau einer souveränen US-Seepräsenz in der Arktis ist schon eingeleitet. Das erste NATO-Manöver fand im Juni 2009 im bündnisfreien Schweden statt. Dies wurde von der Öffentlichkeit leider kaum wahrgenommen.
Auch die EU-Klimastrategie fordert eine eigene Arktispolitik. Für die arktische Region soll eine Geostrategie entwickelt werden, die erstens den Zugang zu den Ressourcen und zweitens die Öffnung neuer Handelsrouten berücksichtigt. Auch hier dient die Armee als Systemadministrator der Globalisierung. Seit dem Balkankrieg wird mit dem Verweis auf Menschenrechte das Völkerrecht ausgehebelt. Daneben wird die von Europa ausgehende NATO-Osterweiterung forciert. Alle Maßnahmen bilden zusammen gewissermaßen einen Keil, mit dem die USA in das Herz der eurasischen Landmasse vorstoßen will.

Das "European Defence Paper" gewährt tiefe Einblicke in die geopolitischen Absichten der EU (Quelle: Institut for Security Studies, Europäische Union)
„Es gibt für die Mehrheit der kontinentaleuropäischen Nationen in absehbarer Zukunft weder einen strategischen noch einen moralischen Grund, sich einem denkbar gewordenen amerikanischen Imperialismus willig unterzuordnen. Wir dürfen nicht zu willfährigen Ja-Sagern degenerieren“, forderte Helmut Schmidt 2004 in seinem Buch „Die Mächte der Zukunft“.24 Mittlerweile hat sich das Kräfteverhältnis weiter zugunsten der USA verschoben. Nach Art. I-41, Abs. 5, des EU-Vertrags kann der Rat „zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen“25 eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung von militärischen Missionen beauftragen. Nach Abs. 8 braucht das Europäische Parlament nur mehr gehört und über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten zu werden. Das Parlament hat somit keinen Einfluss auf die Entscheidung über Krieg und Frieden. Im Klartext bedeutet der Art. I-41: Angriffskriege zur Wahrung ideeller Werte und ökonomischer Interessen.
Die Kriege im Gefolge der Geostrategie höhlen bereits heute das Völkerrecht aus und beschädigen fundamentale Menschenrechte
Wenige Monate vor der Formulierung des EU-Vertrags wurde diese Absicht schon im „European Defense Paper“ angedeutet: Die „ökonomische Überlebensfähigkeit“ der EU müsse durch Stabilitätsexport zum Schutz der Handelsrouten und des Flusses der Rohstoffe gesichert werden. Offen wird vom „präventiven Engagement“ gesprochen.26 Das ist ein strategischer Begriff, der die hegemoniale Absicht kaum noch verbrämt. Europa sollte gerade aus der humanitären und demokratischen Verantwortung heraus die außenpolitischen Absichten der USA kritisch hinterfragen und das Amalgam aus geostrategischen, wirtschaftspolitischen und hegemonialen Interessen nicht beschönigend als „militärischen Humanismus“ beschreiben.27
Die Kriege im Gefolge der Geostrategie höhlen bereits heute das Völkerrecht aus und beschädigen fundamentale Menschenrechte, für deren Einhaltung sie angeblich geführt werden. Wirkliche Friedensarbeit erfordert den Mut, diese Zusammenhänge gegen den Widerstand der Mächtigen aufzudecken und die Werte des abendländischen Humanismus gegen ihre angeblichen Verfechter zu verteidigen. Helmut Schmidt fordert in diesem Zusammenhang die europäischen Nationen auf, ihre Würde zu bewahren, denn: „Die Würde beruht auf dem Festhalten an unserer Verantwortung vor dem eigenen Gewissen.“28 Für diese Verantwortung gibt es in der europäischen Tradition genügend Vorbilder. Auf sie sollten wir uns besinnen.
ANMERKUNGEN
- „Militärpolitischer Berater der Bundesregierung erhebt schwere Vorwürfe gegen NATO-Truppen in Afghanistan", veröffentlicht am 31. Mai 2007 auf WDR.de, siehe auch Fernsehmagazin Monitor, Nr. 563
- Wolfgang Effenberger: „Versuch einer Analyse nach acht Jahren Krieg in Afghanistan. Ursachen der ,demokratischen Entwicklung'“, veröffentlicht am 26. August 2009 in der Neuen Rheinischen Zeitung
- Wolfgang Jamann: „Soldaten sind keine Entwicklungshelfer“, veröffentlicht am 16. August 2009 in Bild am Sonntag, S. 3
- „Oberst Klein wollte ,Feinde des Wiederaufbaus treffen'“ , veröffentlicht am 12. Dezember 2009 auf Spiegel online
- Mathias Gebauer: „Auf Tuchfühlung mit dem Feind“, veröffentlicht am 27. Mai 2009 auf Spiegel online
- Karl-Hellmut Schnell/Heinz-Peter Ebert: Disziplinarrecht, Strafrecht, Beschwerderecht der Bundeswehr. Walhalla Fachverlag, Regensburg, 27. Auflage 2012
- „Ermittlung wegen Kriegsverbrechen“ veröffentlicht am 19. März 2010 in der Süddeutschen Zeitung
- Kommt z. B. zur Anwendung bei Verkehrsunfällen im Straßenverkehr, bei Betriebs- oder Werksunfällen oder sonstigen Unglücksfällen,wie z. B. bei Operationen
- Quelle: Thomas M. Amann, Rechtsanwalt, zitiert unter www.anwalt.de/rechtstipps/mord-totschlag-fahrlaessige-toetung-die-unterschiede_001207.html
- Jürgen Rose: „Spur der Verwüstung“, veröffentlicht am 3. September 2010 auf Freitag.de
- Mathias Gebauer/Holger Stark: „Merkels Versprechen“, veröffentlicht am am 30. August 2010 in Der Spiegel 35/2010
- Ebenda.
- Vgl. Der Spiegel 37/2010 vom 13. September 2010
- Jürgen Heiducoff am 10. August 2012 in einer E-Mail an Wolfgang Effenberger
- Grußwort von Bundespräsident Horst Köhler beim Empfang anlässlich des 60. Jahrestages des 20. Juli 1944, veröffentlicht unter http://www.lpb-bw.de/stauffenberg/unterseiten/rezeption/rezeptionpolitik.htm
- Sebastian Haffner: Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933. dtv, Stuttgart/München 2000, S. 43
- Dies sollte die Rache des Königs für die Plünderung des Schlosses Charlottenburg im Jahre 1760 durch Russen, Österreicher und Sachsen sein, bei der der König seine schöne Antikensammlung verlor.
- Nachzulesen im Plenarprotokoll 14/30, abrufbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/14/14030.pdf
- Antrag der Bundesregierung vom 8. Februar 2007 – BT-Drs. 16/4298
- Auszug des Briefes, zitiert aus Freitag 12/2007, veröffentlicht am 23. März 2007
- „Afghanistan: Erster deutscher Soldat verweigert erfolgreich Tornado-Einsatz“, veröffentlicht am 16. März 2007 auf Spiegel Online
- Nachzulesen im Artikel 24 des „Neuen Strategischen Konzeptes“, Auszug und Analyse eines Briefes vom CDU-Abgeordneten Willy Wimmer an Bundeskanzler Schröder, datiert vom 5. Mai 2001, veröffentlicht in Junge Welt am 23. Juni 2001
- Aschot Manutscharian: „Konflikt statt Potenzial“, S. 15 In: „Global – Kampf um Rohstoffe“, Y. Magazin der Bundeswehr, S. 14ff. Y-07/2007. Ähnlich Manutscharian in: „Machtfrage – Wer besitzt die Welt?“ Y. Magazin der Bundeswehr 2006, Stand vom 9. März 2007. Der Artikel enthält Ungenauigkeiten: 1. Die geplante Ölleitung von Burgas in Bulgarien führt zum griechischen Mittelmeerhafen namens Alexandroupolis; 2. Die BTC-Pipeline von Baku nach Ceyhan ist nicht 1900 km, sondern 1768 km lang; 3. Die Blue-Stream-Pipeline vom Terminal nahe Novorossijsk nach Samsun ist nicht geplant oder im Bau, sondern wurde am 30. Dezember 2002 in Betrieb genommen. Seit Februar 2003 befördert sie russisches Erdgas in die Türkei.
- Helmut Schmidt: Die Mächte der Zukunft. Gewinner und Verlierer in der Welt von morgen. Siedler Verlag, Berlin 2004, Umschlagtext. Siehe auch Wolfgang Effenberger, Rede „Quo vadis Deutschland – Neue Krieg um Rohstoffe?“ anlässlich des Friedensfestivals am 25. Juli 2009 in Berlin, nachzulesen am Ende des Artikels „Ein Festival für die Friedensradler Paris – Berlin – Moskau“, veröffentlicht am 1. September 2012 in der Neuen Rheinischen Zeitung
- „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ der Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten vom 6. August 2004, veröffentlicht unter http://ue.eu.int/igcpdf/de/04/cg00/cg00087.de04.pdf (Zugriff am 1. September 2012)
- „European defense: A proposal for a White Paper“ des Institut for Security Studies der EU, veröffentlicht am Mai 2004 unter http://www.iss.europa.eu/uploads/media/wp2004.pdf (Zugriff am 1. September 2012)
- Ulrich Beck: Über den postnationalen Krieg. In: Blätter 8/1999, S. 984-990, S. 987
- Helmut Schmidt: Die Mächte der Zukunft. Gewinner und Verlierer in der Welt von morgen. Siedler Verlag, Berlin 2004, Umschlagtext
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:
zeitgeist-Suche
Für mehr freien Journalismus!
Buchneuerscheinungen
Unser Topseller
Buch + DVD als Bundle!
Frisch im Programm
Aus unserer Backlist
Meist gelesene Onlinebeiträge
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 1)
- Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten
- Avaaz.org und der geheime Informationskrieg um Syrien
- Das Guttenberg-Dossier (Teil 2)
- Als trojanischer Esel der NATO in den Dritten Weltkrieg
- Enthüllt: Femen
- Der amerikanische (Alb-)Traum
- Der Neffe Freuds – oder: wie Edward Bernays lernte, die Massen zu lenken
- Putsch in Berlin?
- "Double Dip": vom Zusammenbruch unseres Finanzsystems